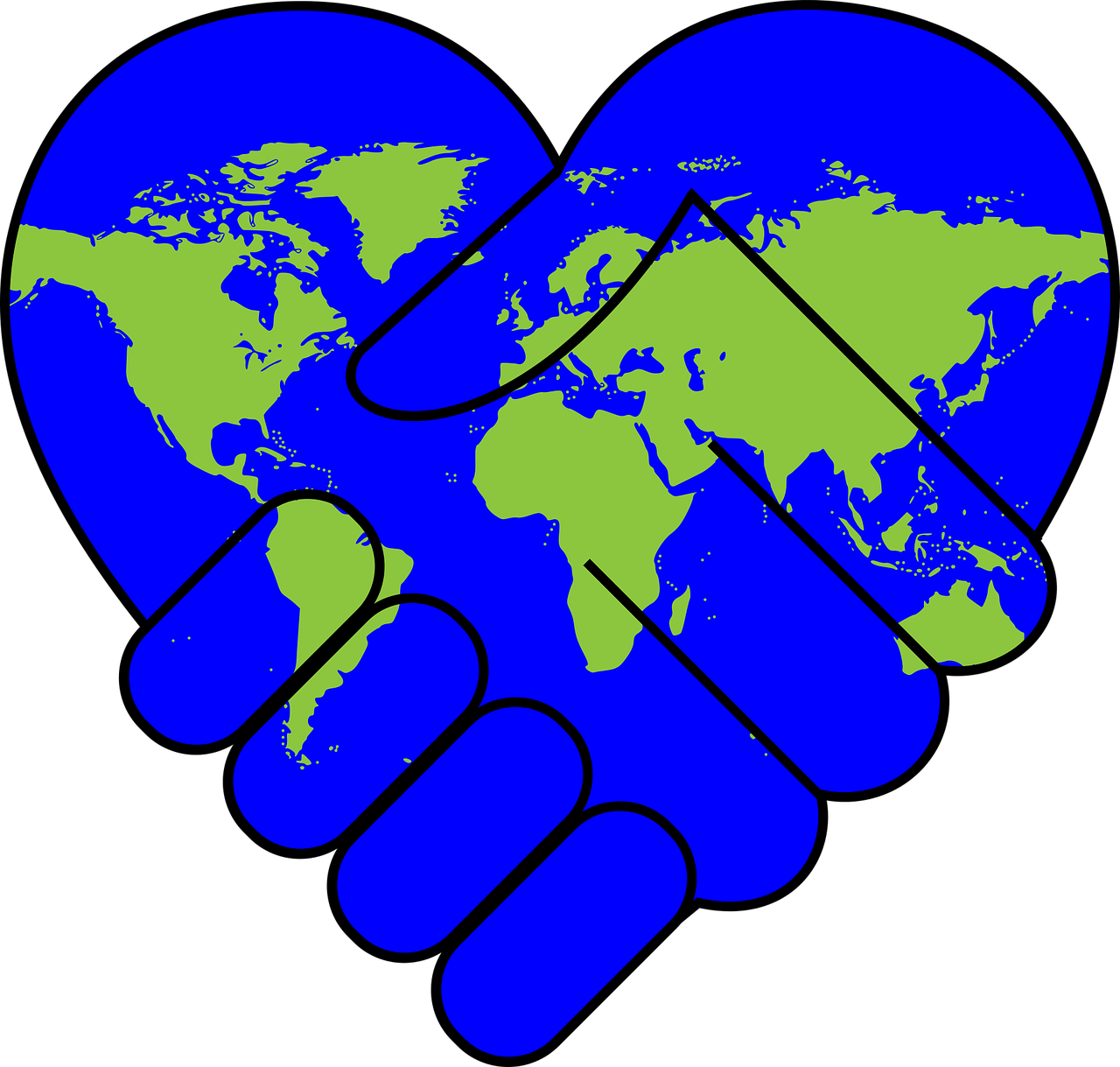Vertrauen reduziert Komplexität
Unter den gegenwärtigen Bedingungen stellt sich die Außenpolitik der Gesellschaften als ein Hürdenlauf dar, zu dem sich immer weniger Teilnehmer anmelden. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen aus dem globalen Süden wenden sich an andere internationale Player. Etwa an Schweden und die Schweiz, die eine empathischere Form der Unterstützung pflegen. Ihre Strategie, die erneut mit Demut zu tun hat: Gemeinsam werden nur die zu erreichenden Ziele eines Projekts festgelegt, die Mittel und Maßnahmen zur Umsetzung und Zielerreichung bestimmen die örtlichen Akteure selbst. Ihre Kernkompetenz ist, mit der Komplexität in ihrem Land umgehen zu können.
Misstrauen erzeugt „Kontrollitis“. Den Wunsch, dass (Steuer-)Gelder transparent und effektiv verwendet werden, teilen die meisten zivilgesellschaftlichen Akteure. Unverständnis finden dagegen immer stärker wuchernde Kontrollmechanismen, als deren Wurzel ich ein grundsätzliches Misstrauen sehe. Sie führen am Ende dazu, dass mehr Zeit für Buchhatung, Finanz- und Sachberichte draufgeht als für die Arbeit mit Menschen, für das Wirken am Friedensprozess, für Entwicklung.
Es braucht von beiden Seiten den Willen, kommunikative Brücken zu schlagen. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe.
Vertrauen reduziert Komplexität. Wie könnte eine vertrauensbasierte „Außenpolitik der Gesellschaften“ aussehen? Als Basis dafür schlage ich etwas sehr Banales vor: Sprecht miteinander! Das ist auch ein Erfolgsrezept für viele Friedensprozesse: über Lagergrenzen hinweg miteinander sprechen, von sich und seinen Erfahrungen, Werten und Haltungen erzählen und dem anderen mit offenem Herzen zuhören. Das bringt Menschen einander nahe. Nun gehören Regierungsmitarbeiter und zivilgesellschaftliche Akteure zwar nicht verfeindeten Gruppen an, aber sie leben durchaus in sehr verschiedenen Kulturen. Erstere im globalen Norden, in finanzieller Absicherung, eingebunden in behördliche und bürokratische Strukturen, oft den Standort zwischen Berlin und ausländischen Botschaften wechselnd. All das verhindert, sich wirklich von Themen, Menschen und deren Anliegen berühren zu lassen. Die anderen engagieren sich im globalen Süden, in prekären finanziellen Verhältnissen, getrieben von einer starken Motivation im Herzen, einen Wandel zum Besseren für ihr Land und dessen Menschen zu erkämpfen. Zwei Lebenswelten, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
Es braucht von beiden Seiten den Willen, kommunikative Brücken zu schlagen. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Die Wege könnten gut moderierte, regelmäßige Dialoge sein, deren Hauptziel es ist, sich gegenseitig empathischer wahrnehmen zu können. Ich behaupte, dass in echten Dialogen die wechselseitigen „Feindbilder“ dahinschmelzen würden.
Eine wissenschaftliche Studie der Psychologin Emily Kubin von der Universität Koblenz-Landau zeigt, dass der Austausch persönlicher Erfahrungen eine der wichtigsten Brücken über gesellschaftliche Gräben hinweg sein kann. Den anderen besser zu verstehen, heißt nicht automatisch, dessen Haltungen und Logiken zu billigen – aber man kann deren Entstehung und Wirkweise besser nachvollziehen.