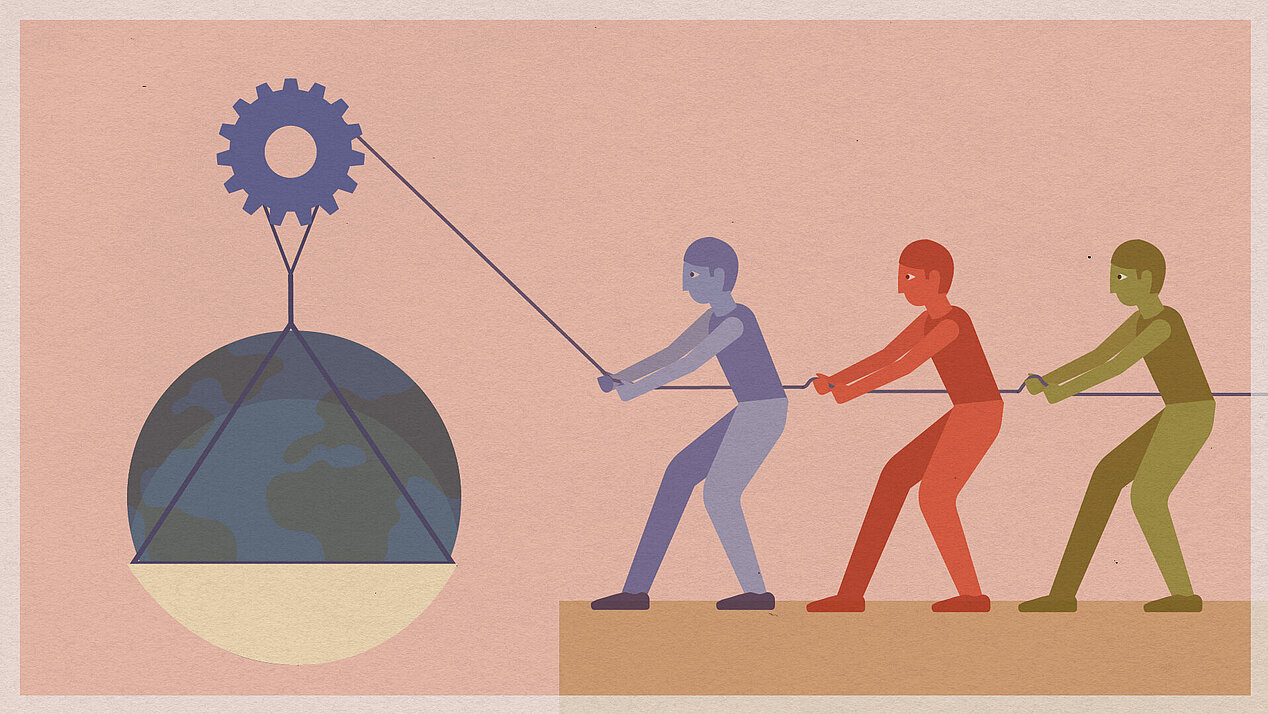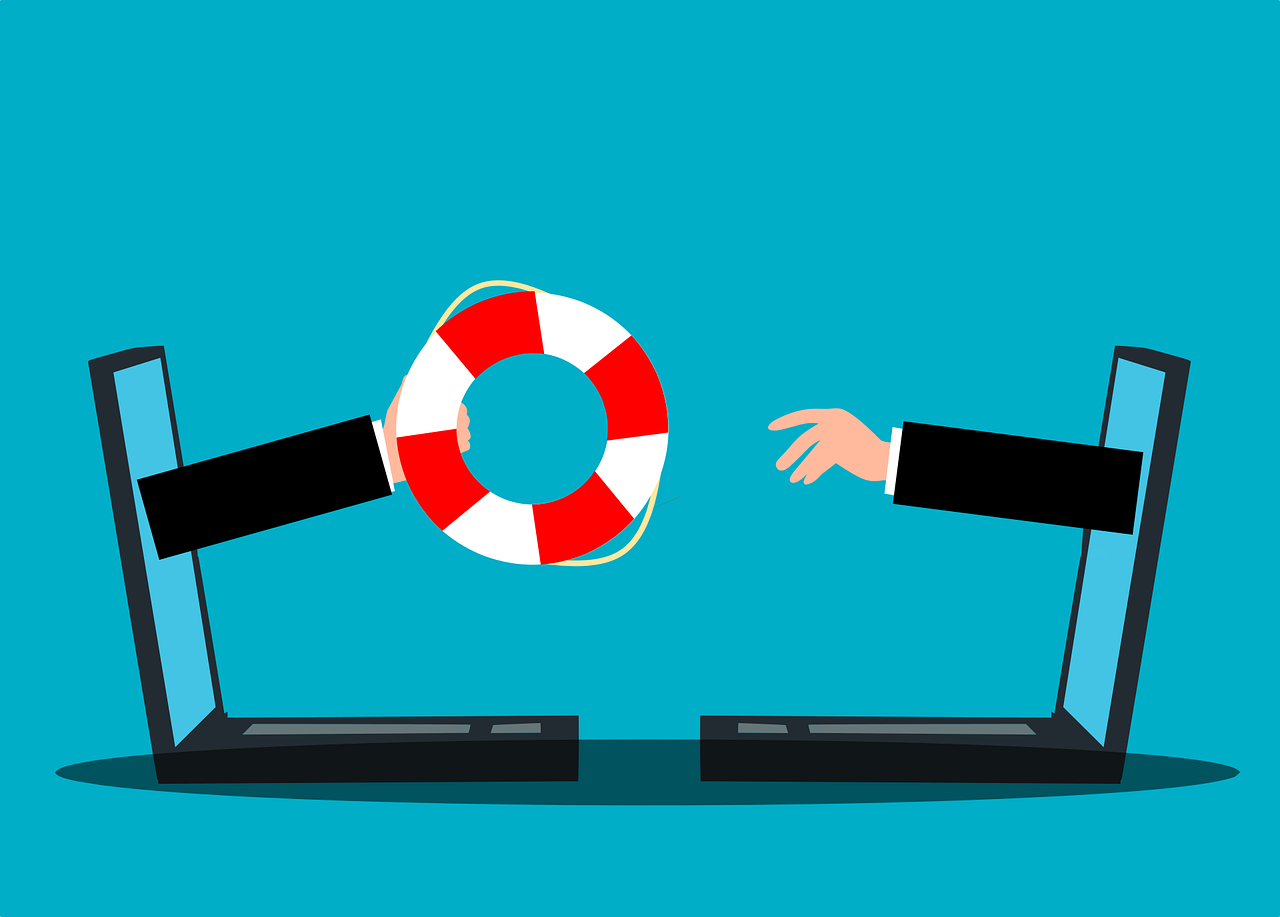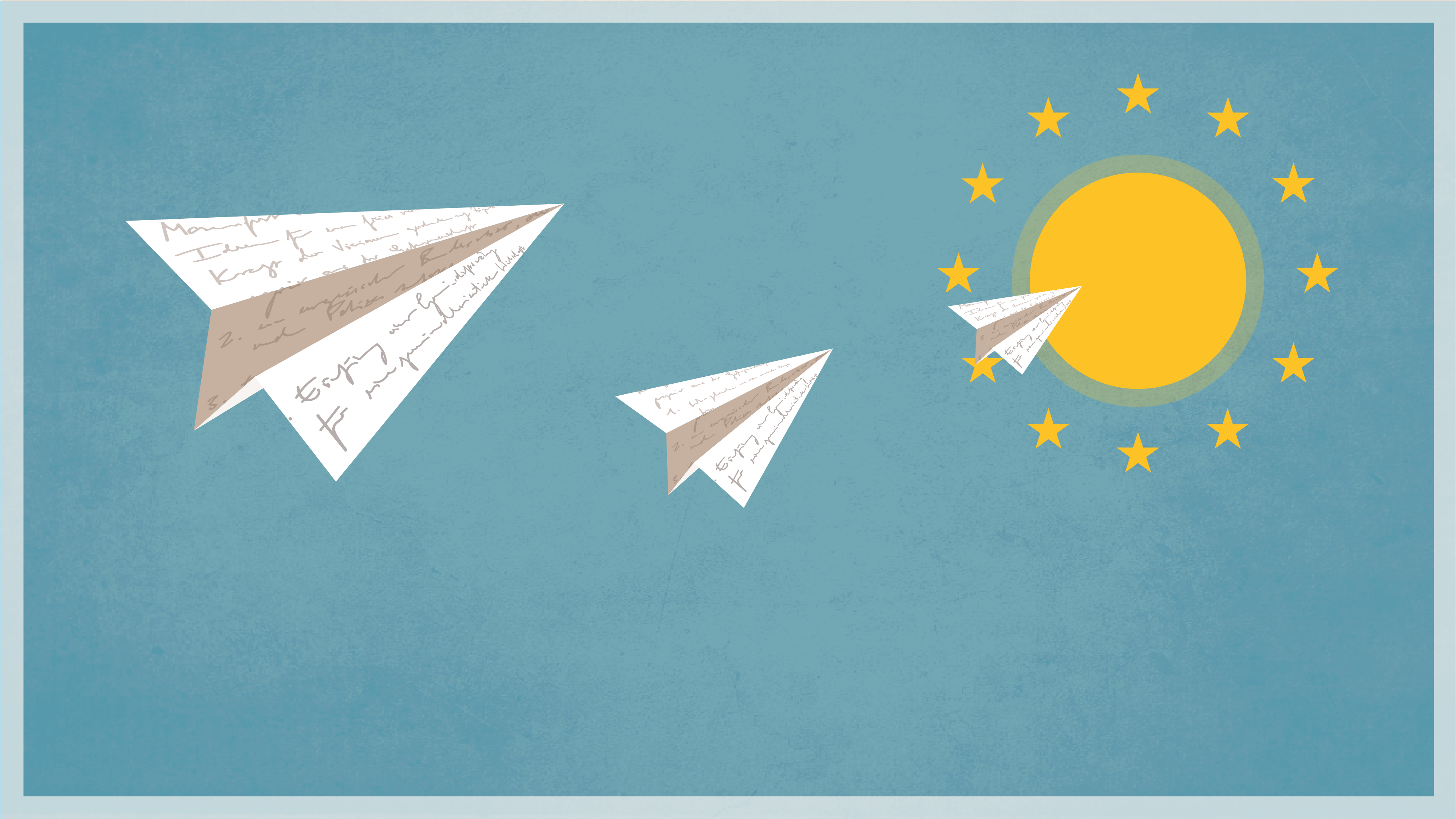Ein Klimapass ist unumgänglich, denn global sind Millionen Menschen wegen plötzlich einsetzender Extremereignisse wie Überflutungen, Stürme, Busch- und Waldbrände auf der Flucht. Schon von 2008 bis 2016 mussten etwa 228 Millionen Menschen aufgrund solcher Katastrophen ihren Wohnort zeitweise oder dauerhaft verlassen, im Durchschnitt mehr als 22 Millionen Menschen pro Jahr.
Noch nicht eingerechnet sind hier Auslöser schleichender Veränderungen wie Dürre und Verschlechterung der Böden und Grundwasserversalzung. Nach Schätzungen der Weltbank werden bis zum Jahr 2050 insgesamt 143 Millionen Menschen in Afrika südlich der Sahara, Südasien und Lateinamerika durch Klimafolgen innerhalb ihrer Länder vertrieben, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
Ein Klimapass ist unumgänglich, denn global sind Millionen Menschen wegen plötzlich einsetzender Extremereignisse [...] auf der Flucht.
„Wenn das morgen in der Bild steht, ist ihr Klimapass tot“, wandte sich jüngst ein wohlsituierter älterer Herr an mich. Was er vorschlägt, fragte ich ihn. Wegsehen, die Tür zuschlagen, Flüchtlinge aus Vanuatu und Tuvalu bitten, lieber zu ertrinken? Klima-Migranten können sich bisher nicht auf den internationalen Flüchtlingsschutz berufen, der nur vor absichtlichem Handeln von Regierungen schützt, wie der Verfolgung wegen religiöser oder politischer Überzeugung, nicht aber vor Umweltveränderungen und Naturkatastrophen. Seit einigen Jahren werden deshalb internationale Pakte zum Thema Flucht und Migration verhandelt.
Den Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, eine einheitliche völkerrechtliche Erklärung zur Migration, gibt es nur auf dem Papier. Auch EU-Staaten wie Ungarn und Österreich verweigerten ihre Unterschrift. Selbst die Bedeutung eines (übrigens nicht rechtsverbindlichen) Globalpaktes wurde aus Furcht vor der völkisch-autoritären Rechten so weit herunter geredet, dass wenig blieb außer europäischer Selbstberuhigung. Doch steht der Klimapass als Offerte an die Bevölkerung flacher Inselstaaten weiter auf der Tagesordnung.
Andernfalls wird wieder ein „Undankbarer“ wie der Schriftsteller Vladimir Nabokov behaupten können, einst Inhaber des grünen Nansen-Passes, dessen kränkliche Farbe verrate, wie der Inhaber angesehen werde: wie ein Verbrecher auf Freigang. Die Lücken des Nansen-Passes sprechen nicht gegen, sondern für eine frühzeitige Befassung mit dem Klimapass. Ein Utopist ist nur, wer nichts tut. Anders als die völkische Rechte behauptet, muss Europa dem Migrationspakt zufolge nicht „alle“ aufnehmen. Am Erfordernis der normativen und operativen Weiterentwicklung eines humanitären Kosmopolitismus ändert das jedoch nichts.
Aufnahmekapazitäten berechnen sich nach objektiven Erfordernissen, wie man in der Bundesrepublik nicht vergessen sollte, die zu Beginn ihrer Geschichte unter schlechteren Bedingungen Millionen Heimatvertriebene aufgenommen hat, – und wie sich heute an den Nachbarstaaten Syriens bestätigen lässt, die die Hauptlast der Massenflucht tragen. Migration ist in diesen Zeiten und in dieser Welt normal und auch wünschenswert. Wer eine Flüchtlings-und Energiepolitik betreibt, die einzig kurzfristigen nationalen Interessen folgt, verhindert pragmatische und multilaterale Lösungen einer geregelten Einwanderung und wird sehr bald von der Wirklichkeit überrollt werden.