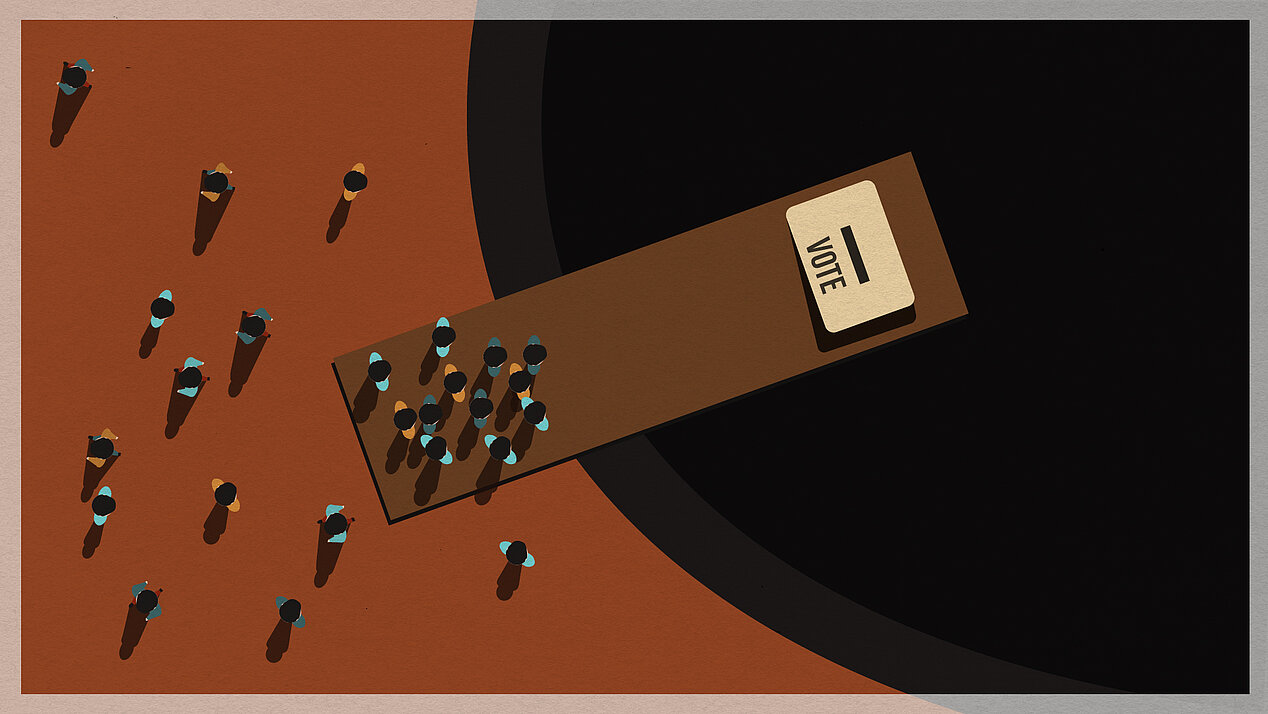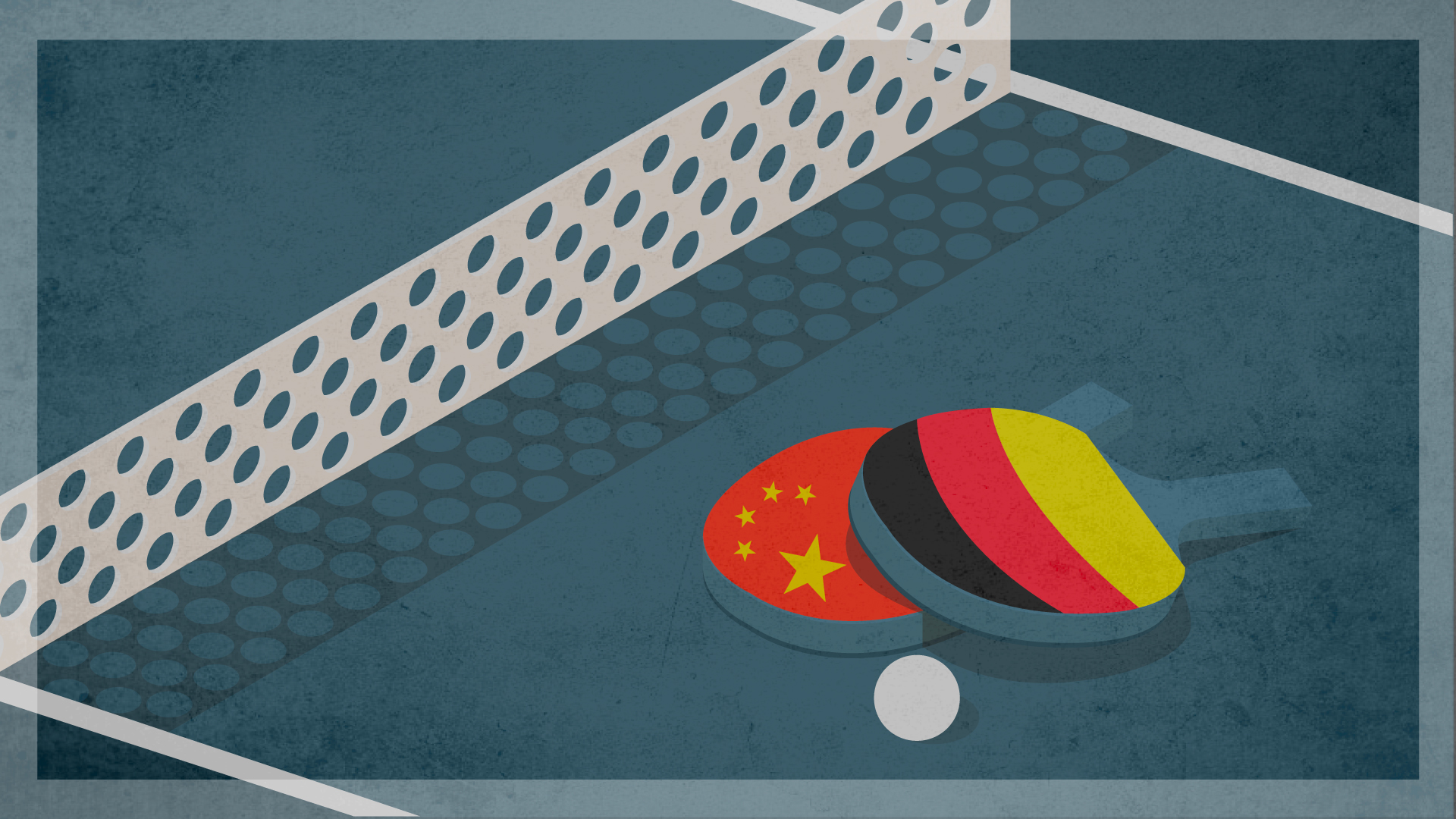Ins Kraut schießende Phantasien
All das geschah mit nervösem Blick auf die sowjetische Propaganda, die unermüdlich und unwiderlegbar auf die organisierte Entwürdigung der Afroamerikaner in den USA hinwies. Milton Friedman konnte 1970 mit einem freundlichen ideologischen Klima rechnen, als er im New York Times Magazine behauptete, die Unternehmen hätten keine andere soziale Verpflichtung als die, Profite zu machen.
Er war das öffentliche Gesicht eines ideologischen Wandels, in dessen Rahmen libertäre Ökonomen wie James Buchanan gemeinsam mit dem rechten Eiferer Charles Koch und Lobbyisten von Firmen wie Shell Oil, Exxon, Ford, IBM, der Chase Manhattan Bank und General Motors mit Hilfe willfähriger Medien und eines neuen Lehrplans für die Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten ihre radikalen Vorstellungen verbreiteten.
Das Reagan-Thatcher-Modell [...] setzt eine unvorstellbar große Zahl von Menschen einem vorzeitigen Tod oder einem verzweifelten Existenzkampf aus.
Zum Teil infolge ihres Einflusses und ermutigt durch Reagans und Thatchers Rhetorik, begannen Politiker des gesamten ideologischen Spektrums in den 1980er Jahren, soziale Sicherungen abzubauen, die Arbeitnehmerrechte einzuschränken und die Steuern für die Reichen massiv zu senken. Dieser Prozess beschleunigte sich noch nach dem „Sieg“ des Westens im Kalten Krieg, als Phantasien über eine Amerikanisierung der gesamten Welt ins Kraut schossen: „Ich möchte, dass alle Amerikaner werden“, erklärte Thomas Friedman, Globalisierungsberater von CEOs und auf Modernisierung bedachten Despoten, noch 2008.
Von Thatcher und rechten Thinktanks in den USA inspiriert, drängte Tony Blair die staatliche Politik und die Einstellung der britischen Öffentlichkeit noch weiter in Richtung der Vorstellung, staatliche Wohlfahrtssysteme seien eher ein Problem als die Lösung. Über das letzte Jahrzehnt schredderten mehrere aufeinanderfolgende konservative Regierungen im Zuge ihrer „Sparpolitik“ skrupellos, was von den sozialen Sicherungssystemen geblieben war. Sie beschleunigten damit den Verfall Großbritanniens zu einem scheiternden – wenn nicht gar gescheiterten – Staat, der nicht einmal die Versorgung seines Krankenhauspersonals mit Schutzmasken und Handschuhen zu sichern vermag.
In den USA wurde „Sozialhilfe“ durch Reagans Ausfälle gegen „Sozialhilfebetrüger“ („welfare queens“) zu einem Schimpfwort, danach geriet sie unter intensiven Beschuss durch Bill Clinton. Die chaotische Reaktion auf Hurrikan Katrina bewies, dass George W. Bush „sich nicht für Schwarze interessiert“, wie es der (heute umstrittene) Kanye West ausdrückte, während die Nachwirkungen der Finanzkrise zeigten, dass Barack Obama sehr darauf bedacht war, nicht den Eindruck zu erwecken, er interessiere sich allzu sehr für Schwarze. Der schwarze US-Präsident belehrte Afroamerikaner über individuelle Verantwortung, während er seine zukünftigen Zahlmeister an der Wall Street vor dem Ruin rettete.