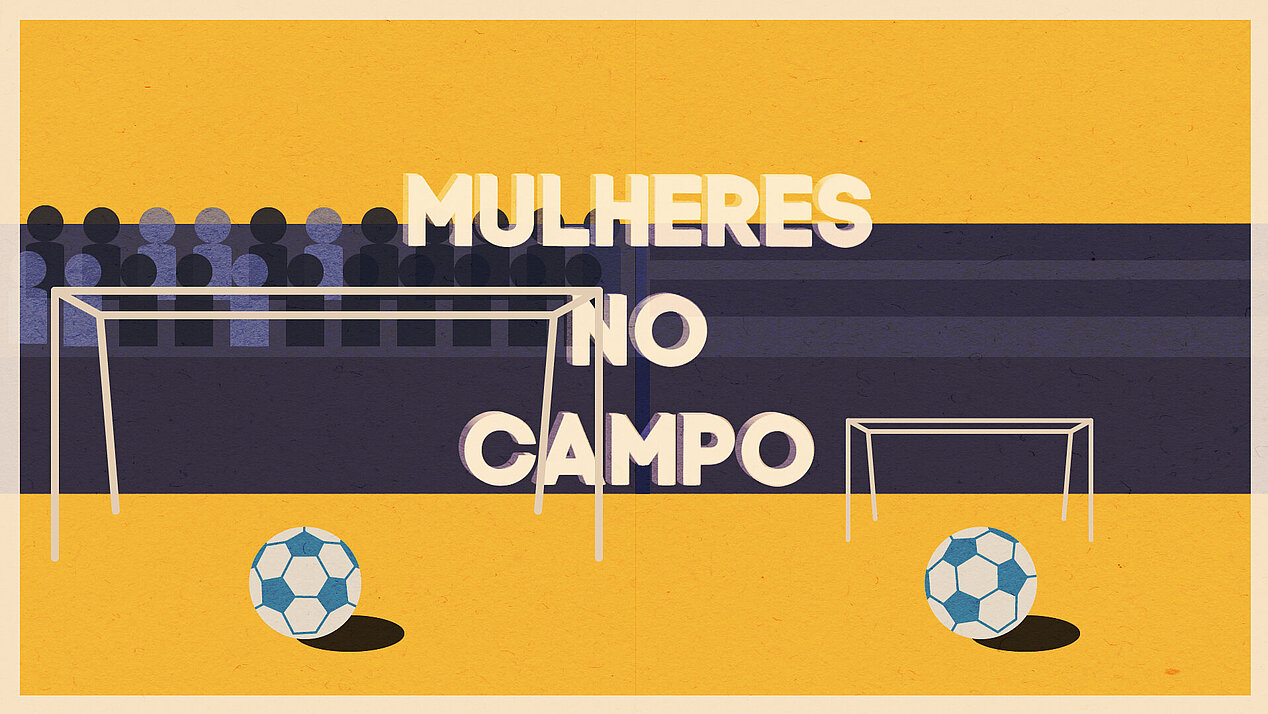Indem man Jungen und Mädchen zusammen spielen ließ, versuchten die Nichtregierungsorganisationen Vorurteile auf dem Fußballfeld abzubauen. Die Jungen sollten die Mädchen als ebenbürtige Spieler wahrnehmen. Da dies in Rio de Janeiro stattfand, ein Schauplatz mehrerer Weltmeisterschaftsspiele, erregten die Ausstellung und die Sportaktivitäten die Aufmerksamkeit einheimischer und ausländischer Journalisten.
Andere Nichtregierungsorganisationen und öffentliche Institutionen profitierten ebenfalls von sportlichen Großereignissen in Brasilien. Im Mai 2015 eröffnete das nationale Fußballmuseum in São Paulo, das Museu do Futebol, eine neue Ausstellung über die Geschichte der Frauen im brasilianischen Fußball. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte das Museum, das 2008 gegründet worden war, fast ausschließlich Männerfußball und männliche brasilianische Spieler präsentiert. Nun zeigen neue Ausstellungen die Geschichte von Frauenteams und von Sportlerinnen. Zeitungsartikel illustrieren die Jahre, in denen männliche Journalisten und Ärzte für den Ausschluss der Frauen aus dem brasilianischen Fußball plädierten, und in denen es Frauen in den 1940er Jahren verboten wurde, zu spielen. Auf ähnliche Weise wie die Kuratoren der Ausstellung in Rio de Janeiro profitierten die Akademiker des Museums in São Paulo von den neueren sportlichen Großereignissen in ihrem Land, um öffentliche Aufmerksamkeit zu erzielen.
Im Vorfeld der Olympischen Spiele 2016 verfolgt REDEH eine ähnliche genderpolitische Strategie wie während der Fußballweltmeisterschaft der Männer. In vielen olympischen Disziplinen wurden Frauen in der Vergangenheit diskriminiert. Heutzutage sind Sportlerinnen in vielen Sportarten in Brasilien wie auch in anderen Ländern weltweit immer noch eine Minderheit. Im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen im August 2016 plant die Nichtregierungsorganisation, das Potenzial der Frauen im Sport durch ein Bildungsprogramm sichtbar zu machen.
Aber nicht nur brasilianische Aktivisten, auch internationale zivilgesellschaftliche Organisationen nutzen sportliche Großereignisse in Brasilien, um über soziale und genderbedingte Ungleichheiten in Fußball und Gesellschaft zu diskutieren. Zum Beispiel organisierte die deutsche Nichtregierungsorganisation Discover Football während der Fußballweltmeisterschaft der Männer 2014 eine Ausstellung und ein Trainingslager für Mädchen aus sozial marginalisierten Vierteln in Rio de Janeiro. Anschließend veröffentlichte Discover Football auf ihrer Webseite Informationen zu diesen Events. Die Nichtregierungsorganisation führte ihren internationalen Kampf für Frauenfußball und Frauenrechte in Brasilien fort. Und so wurden Brasilien und besonders Rio de Janeiro zu Bühnen für das nationale und internationale genderpolitische Engagement.
Der Fußball der brasilianischen Frauen profitiert nicht nur von sportlichen Großereignissen wegen medialer und politischer Aufmerksamkeit, sondern auch auf der materiellen Ebene. Der Weltfußballverband Fifa stellte Brasilien zusätzliche Mittel zur Verfügung, um den Wettkampf des Männerfußballs auszurichten. Ein Teil dieser Mittel musste für die Entwicklung genderspezifischer Sportprogramme und des Frauenfußballs eingesetzt werden.
Neben der Organisation von Wettkämpfen für Nachwuchsspielerinnen förderte die Brasilianische Fußballföderation Fußballprojekte für Mädchen, wie zum Beispiel Estrela Nova mit Sachspenden.
Aus der Perspektive von Estrela Nova hatten die Spenden auch einen wichtigen immateriellen Wert und eine motivierende Wirkung. Zum ersten Mal bekam die Nichtregierungsorganisation von einer brasilianischen Fußballinstitution öffentliche Anerkennung für ihr soziales Engagement. Aber die genderspezifische Förderung durch die Fifa ist nur für eine begrenzte Zeitspanne vorgesehen. Da eine vergleichbare Förderung von der Brasilianischen Fußballföderation selten ist, wird die Unterstützung für Frauenfußball-Verbände zukünftig wahrscheinlich nachlassen. In diesem Fall hätte die Fußballweltmeisterschaft der Männer 2014 nur einen kurzen positiven Effekt gehabt.
Brasilianische Aktivisten und internationale zivilgesellschaftliche Organisationen nutzen sportliche Großereignisse in Brasilien, um über soziale und genderbedingte Ungleichheiten in Fußball und Gesellschaft zu diskutieren.
Trotz allem aber wirken sich auch die Olympischen Spiele 2016 positiv auf den brasilianischen Frauenfußball aus, insbesondere auf das Nationalteam der Frauen. Seit der Gründung Ende der 1980er Jahre hat das brasilianische Nationalteam der Frauen von brasilianischen Fußballinstitutionen wenig Unterstützung erhalten, was die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen wie den Olympischen Spielen schwierig machte.
Unterbrechungen in der brasilianischen Fußballliga der Profifrauen und Auflösungen von weiblichen Teams wegen finanzieller Engpässe im Frauenfußball waren Gründe für fehlende Praxis und Wettkampferfahrung. Trotz talentierter Sportlerinnen im brasilianischen Team war der Wettkampf gegen Länder mit höchst kompetitiven Nationalligen wie USA oder Schweden hart.
Heute wird das brasilianische Team der Frauen intensiver vorbereitet als in früheren Wettkämpfen. Die Chance auf überzeugende Leistungen in den Olympischen Spielen in Brasilien hat die Finanzierung des Nationalteams der Frauen angekurbelt. Doch nachhaltige Effekte und die Finanzierung des Frauenfußballs nach den internationalen Sportwettkämpfen sind fraglich. Abgesehen davon profitiert der einheimische Amateurfußball der Frauen wahrscheinlich nicht von diesen Anreizen.
Kurz zusammengefasst: 2013 und 2014, vor der Fußballweltmeisterschaft der Männer und den Olympischen Spielen in ihrem Land, protestierten die Brasilianer gegen soziale Ungerechtigkeiten. Genderungleichheiten betreffen sehr deutlich verschiedene Bereiche der brasilianischen Gesellschaft.
Diese Ungleichheiten wurden von einer kleinen Gruppe Protestierender öffentlich gemacht. Frauenfußball-Klubs, einheimische und internationale Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaftler konzipierten politische Programme zu Gender-Themen und profitierten von der nationalen und internationalen Medienaufmerksamkeit während der Fußballweltmeisterschaft der Männer und vor den Olympischen Spielen.
[...] nachhaltige Effekte und die Finanzierung des Frauenfußballs nach den internationalen Sportwettkämpfen sind fraglich.
Es ist ihnen gelungen, das öffentliche Bewusstsein für Genderungleichheiten im brasilianischen Sport und insbesondere im Fußball zu schärfen, und über Frauenrechte zu diskutieren. Der Frauenfußball profitierte auch von Brasiliens Gastgeberrolle für internationale sportliche Großereignisse, da einige Gruppen und Organisationen zusätzliche Förderungsmittel erhielten.
Doch trotz der positiven Auswirkungen sportlicher Großereignisse ist die Förderung des Frauenfußballs wahrscheinlich nicht von langer Dauer. Zudem ist die Investition in den Frauenfußball in Brasilien im Vergleich zum Männerfußball immer noch unbedeutend. Denkt man an frühere politische Massenproteste, so scheinen viele soziale und politische Themen im Vorfeld der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro noch ungelöst. Es ist immer noch unklar, wie sich die politische und gesellschaftliche Dynamik bis August 2016 entwickeln wird. Wenn es neue Protestbewegungen gibt, spielen sportliche Großereignisse vielleicht wieder eine bedeutende Rolle.