
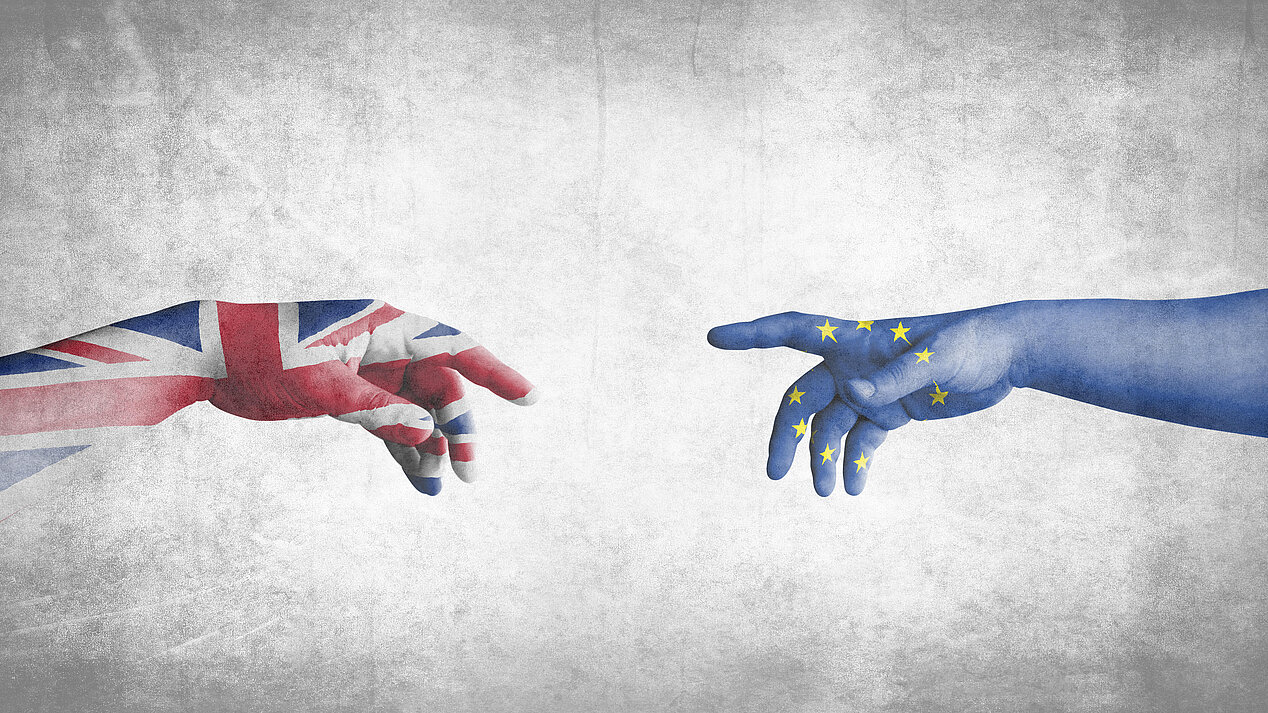
Einer der wichtigsten Berater Kaiser Karls des Großen war ein Angelsachse, nämlich der Gelehrte Alkuin von York. Meine Universität in Oxford ist seit 900 Jahren eine europäische Universität. Eine Geschichte Europas, die all die eigenständigen und gemeinsamen Beiträge von Engländern, Schotten, Walisern und Iren, von Shakespeare, Adam Smith, Winston Churchill und George Orwell unerwähnt ließe, wäre wie ein Symphonieorchester ohne Streicher (oder vielleicht eher ohne die Blechbläser?).
Wie ich am Tag nach dem Brexit-Votum schrieb, kann Großbritannien Europa genauso wenig verlassen wie der Piccadilly Circus London.
Doch jeder gelangt auf seinem ganz eigenen Weg zu einem bewussten Selbstverständnis als Europäer. Ich wurde zu einem leidenschaftlichen Europäer durch meine intensive, unvergessliche persönliche Erfahrung, in einem geteilten Deutschland zu leben, die Entstehung der Solidarność-Bewegung in Polen mitzuverfolgen und zusammen mit bedeutenden mitteleuropäischen Karlspreisträgern wie Václav Havel, Bronisław Geremek und György Konrad, in Warschau, Prag, Budapest und Berlin die Befreiung mitzuerleben. In diesen inspirierenden Zeiten marschierten die Sache der Freiheit und die Sache Europas vereint, Arm in Arm: Freiheit bedeutete Europa, Europa bedeutete Freiheit.
Tatsächlich habe ich noch nie in meinem Leben so viel leidenschaftliches Pro-Europäertum erlebt wie im heutigen Großbritannien [...].
Bekanntlich verstehen sich nicht alle meine Landsleute so freudig als Europäer. Als ich die Dankrede von Tony Blair für die Verleihung des Aachener Karlspreises 1999 an ihn noch einmal las, konnte ich mir ein ironisches Lächeln nicht verkneifen. Seine zentrale Botschaft lautete: „Großbritannien muss seine ambivalente Einstellung gegenüber Europa überwinden.“
Diese ambivalente Haltung ist freilich keine britische Besonderheit mehr – sozusagen das politische Pendant zu Fish ‘n‘ Chips. „Britische“ Euroskepsis und nationalistischer Populismus finden sich heute in allen Ecken des Kontinents.
Ebenso wenig ist die britische Ambivalenz mit dem Brexit-Votum wie von Zauberhand irgendwie verschwunden. Tatsächlich habe ich noch nie in meinem Leben so viel leidenschaftliches Pro-Europäertum erlebt wie im heutigen Großbritannien, insbesondere in Schottland, in London und unter jungen Menschen.
Nicht wenige der 48 Prozent, die für den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union stimmten, haben sich noch immer nicht mit dem Ergebnis abgefunden. Mit der EU-Mitgliedschaft ist es wie mit der Gesundheit: Man weiß sie erst dann wirklich zu schätzen, wenn sie verloren geht. Aber seien Sie versichert: Wir britischen Europäer haben nicht aufgegeben.
Das bringt mich zu einer wichtigen Frage, die das Verhältnis zwischen Individuum und Kollektiv betrifft. Die Idee einer formellen, rechtlichen Art von individueller EU-Staatsbürgerschaft für britische PostBrexit-Europäer ist sicherlich unrealistisch, aber einer politischen Gemeinschaft, die ihre Mitglieder lediglich über ihre Zugehörigkeit zu einem Mitgliedstaat definiert und die einen selbst in intellektuellen und politischen Debatten ständig nach dem Pass fragt, fehlt etwas. Wenn wir unser europäisches Gemeinschaftsgefühl vertiefen wollen, müssen wir lernen, uns gegenseitig als individuelle Europäer zu sehen und anzuerkennen.
Politik und Geschichte haben unterschiedliche Zeitrechnungen. Ein britischer Premierminister bemerkte einmal, eine Woche sei in der Politik eine lange Zeit. Die Uhr der Geschichte dagegen misst in Jahrhunderten. Nun lässt sich die europäische Geschichte über die Jahrhunderte deuten als fortwährendes Oszillieren zwischen Zeiten europäischer Ordnung, so hegemonial und ungerecht diese Ordnungen auch immer sein mochten, und Phasen üblicherweise gewaltsamer Unordnung. So gesehen ist unsere Epoche ziemlich exzeptionell.
Denn in den über 70 Jahren seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben wir in Europa keinen großen zwischenstaatlichen Krieg mehr erlebt. Ich finde in den letzten zehn Jahrhunderten keinen vergleichbar langen Zeitraum ohne einen großen Krieg.
Nun muss man sofort dazusagen, dass es in Europa seit 1945 ganz schreckliche Kriege gegeben hat, vom griechischen Bürgerkrieg über die blutigen Kriege im ehemaligen Jugoslawien bis zum Krieg in der Ukraine, der von Wladimir Putin initiiert wurde. Aber es gab keine großen Kriege. Das ist umso bemerkenswerter, als es in diesem Zeitraum zu einer tektonischen Verschiebung von einer Ordnung zu einer anderen kam: zum Ende des sowjetischen Imperiums und des Kalten Krieges in den Jahren 1989 bis 1991. In der Vergangenheit wäre ein solch grundstürzendes Ereignis mit einem Krieg einhergegangen.
Nie zuvor waren so viele europäische Länder freiheitliche Demokratien, von denen sich die meisten in den gleichen politischen, wirtschaftlichen und sicherheitsspezifischen Gemeinschaften wiederfinden. Um Winston Churchills berühmte Bemerkung über die Demokratie aufzugreifen: Das ist das denkbar schlechteste Europa, abgesehen von allen anderen Europas, die zeitweilig ausprobiert wurden.
Doch der Historiker mag auf diese Zeitspanne von über 70 Jahren blicken und sagen: „Nun ja, eine große Krise ist wahrhaft überfällig.“ Und zweifellos verbinden sich die zahlreichen Krisen, mit denen verschiedene Teile Europas heute zu kämpfen haben, zu einer existenziellen Krise des gesamten europäischen Projekts, wie es sich seit 1945 entwickelt hat.
Hier spielen der Historiker und der Politiker, oder allgemeiner Intellektuelle und Politiker, zwangsläufig unterschiedliche Rollen. Meine Aufgabe lässt sich ganz einfach so zusammenfassen: Es geht darum, nach der Wahrheit zu suchen, die Wahrheit ausfindig zu machen, soweit das kritisch überprüfte Belege und rationale Argumente erlauben, und dann diese Wahrheit so sorgfältig, deutlich und lebendig wie möglich auszusprechen.
Ich tue also meinen Job, wenn ich versuche, die Ursachen dieser existenziellen Krise auszumachen und auf die Schwachstellen hinzuweisen, die nationalistische Populisten ausnutzen. So übt beispielsweise ein direkt gewähltes Europaparlament tatsächlich beträchtliche demokratische Kontrolle über europäische Gesetze und politische Maßnahmen aus, doch die meisten Europäer haben nicht das Gefühl, dass sie in Brüssel direkt vertreten werden und ihre Stimme dort Gehör findet.
Viele europäische Gesellschaften haben große Schwierigkeiten damit, Ausmaß und Tempo der Zuwanderung zu akzeptieren, nicht zuletzt derjenigen, die durch den Abbau der Binnengrenzen in Europa bei gleichzeitiger unzureichender Sicherung der Außengrenzen des Schengenraums erleichtert wird.
Und ich hoffe, dass sich der Karlspreisträger des Jahres 2002 – der Euro – nicht persönlich beleidigt fühlt, wenn ich darauf hinweise, dass die Eurozone, die ursprünglich die europäische Einigung vorantreiben sollte, in den letzten Jahren schmerzliche Gräben zwischen Nord- und Südeuropa entstehen ließ. Das sind unbequeme Wahrheiten, aber ich glaube, der Geist des Alkuin von York würde mir beipflichten, dass es Aufgabe des Wissenschaftlers ist, sie auszusprechen.
Der Politiker dagegen muss immer von den aktuellen Gegebenheiten ausgehen, er muss stets auf seine Worte achten und ein Gefühl des „yes, we can“ – oder auf Deutsch „wir schaffen das“ – vermitteln.
Der Intellektuelle muss die Wahrheit aussprechen, dass kein Imperium, kein Staatenbund, kein Bündnis und keine Gemeinschaft auf Erden je ewig währten, und das wird auch im Falle der Europäischen Union nicht anders sein. Der Politiker muss darauf hinarbeiten, dass unser beispielloses, freiwilliges, friedliches europäisches Imperium so lange wie menschenmöglich Bestand hat.
Übersetzung von Andreas Wirthensohn

Der Kultur kommt im europäischen Einigungsprozess eine strategische Rolle zu. Wie steht es um die Kulturbeziehungen innerhalb Europas? Wie kann Kulturpolitik zu einer europäischen Identität beitragen? Im Kulturreport Fortschritt Europa suchen internationale Autor:innen Antworten auf diese Fragen. Seit 2021 erscheint der Kulturreport ausschließlich online.
