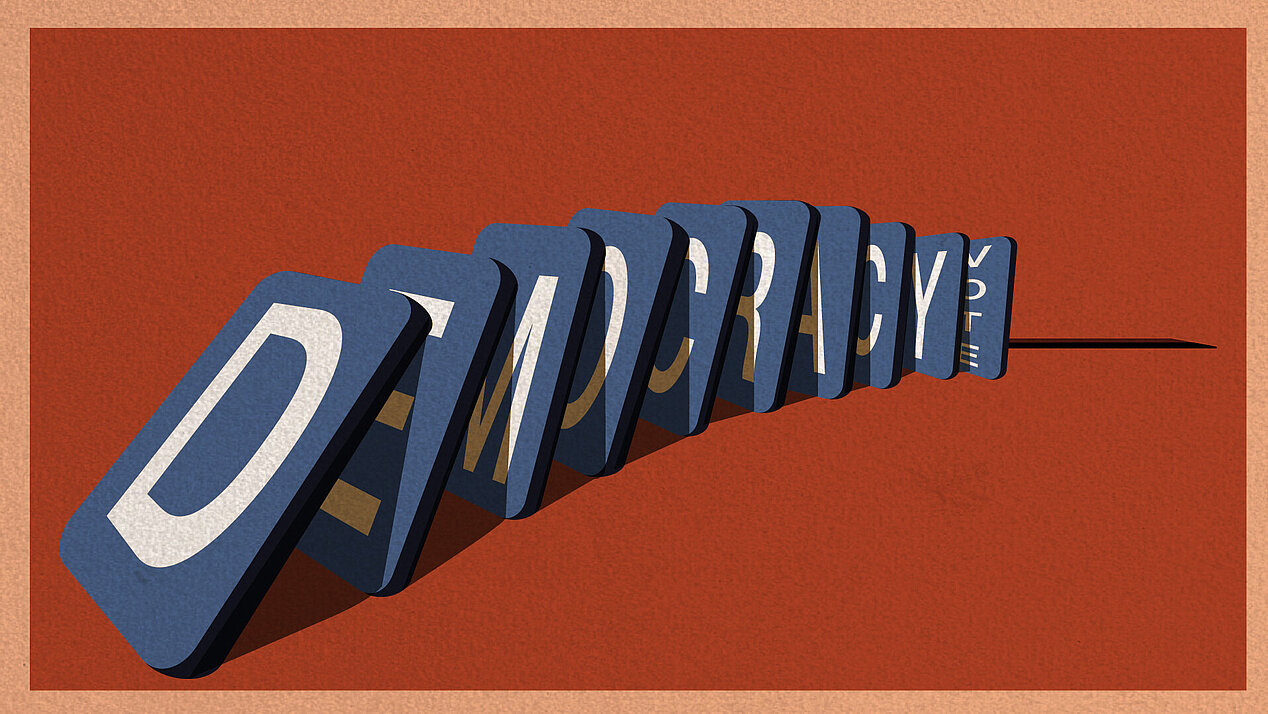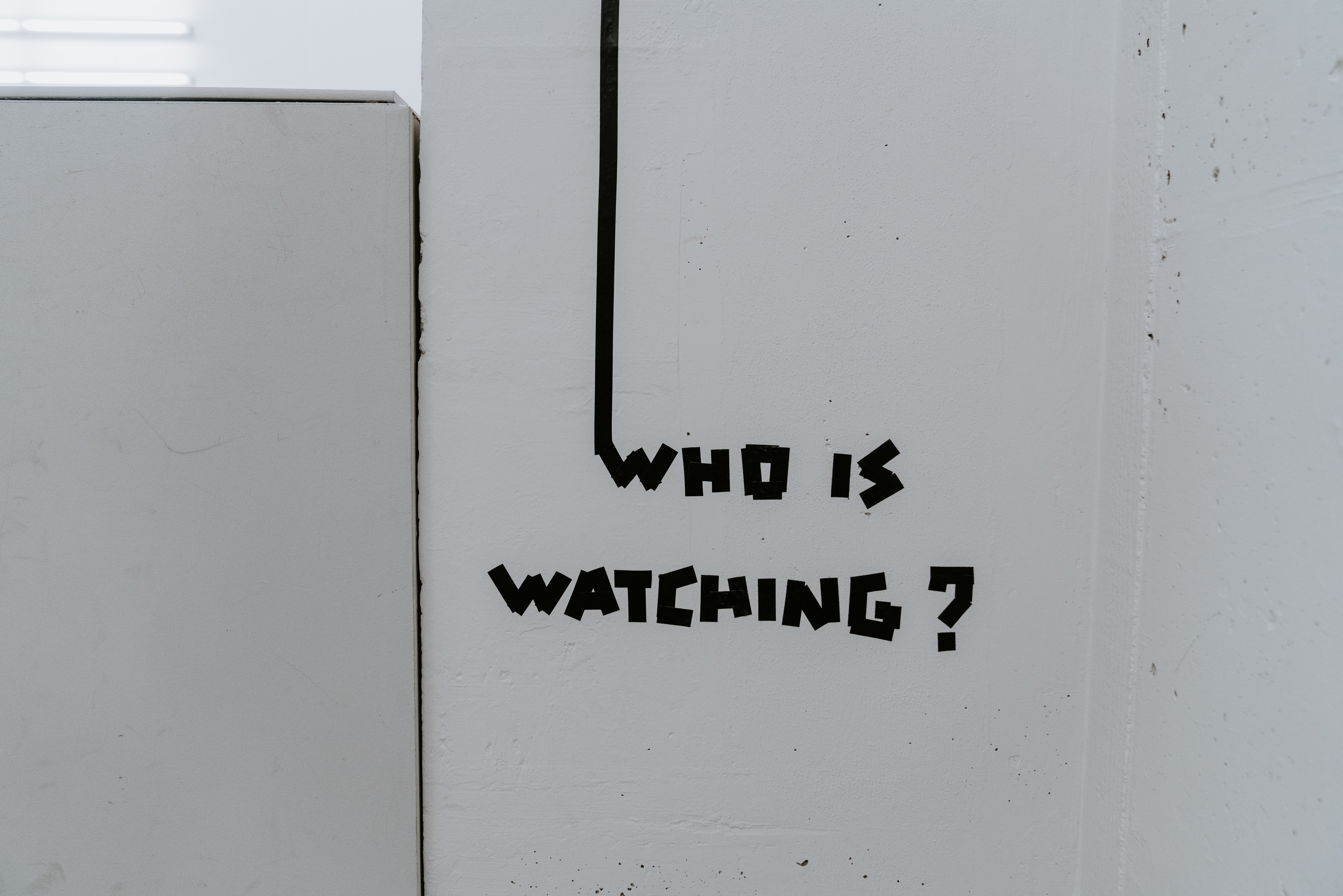Nicht nur düster
Das britische Außenministerium warnt, dass Russland und China „die Schaltstellen für Menschenrechte innerhalb des UN-Systems angreifen“ und dass China den Menschenrechtsrat nutzt, um seine „alternative Vision von Menschenrechten“ zu fördern. In Ägypten kommt Präsident al-Sisi mit Folter und Unterdrückung davon, wohl wissend, dass EU-Ratspräsident Tusk die Tatsache zu schätzen weiß, dass die illegale Migration aus Ägypten nach Europa von fast 13.000 im Jahr 2016 auf fast null im Jahr 2018 zurückgegangen ist.
Das Bild ist jedoch nicht nur düster. Die Gesetze zu Menschenrechten zeigen Wirkung. Im Jahr 2016 befand ein Ad-hoc-Tribunal in Dakar den ehemaligen tschadischen Präsidenten Hissène Habré der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Kriegsverbrechen für schuldig. Die internationalen Gerichtshöfe für Ruanda und das ehemalige Jugoslawien haben den Opfern von Kriegsverbrechen und Völkermord eine Stimme gegeben. Der Internationale Strafgerichtshof erinnert künftige Täter von Massengewalt und Aggressionen daran, dass sie individuell zur Verantwortung gezogen werden. 1977 hatten nur 17 Länder die Todesstrafe abgeschafft, heute sind es 140 – fast zwei Drittel aller Länder der Welt.
Auch die langfristigen Entwicklungen sollten nicht übersehen werden. So schwach und enttäuschend die internationalen Normen im Hinblick auf Menschenrechte auch sein mögen, wir leben nicht mehr in einer Welt ohne Regeln, in der Welt, die Thomas Hobbes als dazu verdammt sah, in einem ständigen Kriegszustand zu leben. In nur wenigen Jahrzehnten haben sich die meisten souveränen Staaten der Welt darauf geeinigt, Verträge einzuhalten, in denen das Recht auf ein menschenwürdiges Leben verankert ist. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.
Eine Minderheit von Staaten entzieht sich dem globalen Reglement zu Menschenrechten teilweise oder vollständig.
Dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte sind 172 Staaten beigetreten. China hat ihn zwar unterzeichnet, aber nicht ratifiziert. Dem Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe sind 164 Staaten beigetreten; Indien hat unterzeichnet, aber nicht ratifiziert. Dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) sind bisher insgesamt 123 Staaten beigetreten. China, Indien, Pakistan, Russland, die Türkei und die USA gehören zu den Ländern, die sich geweigert haben.
Wie dieser kurze Überblick zeigt, gibt es eine Minderheit von Staaten, die sich dem globalen Reglement zu Menschenrechten teilweise oder vollständig entziehen. Zu dieser Gruppe zählen Autokratien wie Saudi-Arabien und China.
Die wichtigsten internationalen Menschenrechtsverträge wurden jedoch von der Mehrheit der Staaten ratifiziert, die alle Regionen der Welt vertreten. Es mag sein, dass Regierungen die Verträge nicht einhalten, aber wenn sie dies tun, berufen sich die Opfer immer auf die globalen Standards. Die Menschenrechte sind eindeutig nicht nur ein europäisches Konstrukt ohne Legitimität jenseits des Westens.
Gleichwohl gibt es nach wie vor einige bemerkenswerte Anomalien. Unter den demokratischen Ländern ist die Abwesenheit Indiens von der Konvention gegen Folter und dem Internationalen Strafgerichtshof besonders auffällig, ebenso wie das Zögern der Vereinigten Staaten, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau zu ratifizieren und dem Internationalen Strafgerichtshof beizutreten. Es entbehrt auch nicht einer gewissen Ironie, dass die europäischen Regierungen ihren Bürgern im Bereich Menschenrechte keinen Zugang zu internationalen Mechanismen für Beschwerden gewähren wollen. Wenn demokratische Länder international erfolgreich Menschenrechte schützen wollen, müssen sie mit gutem Beispiel vorangehen. Glaubwürdigkeit beginnt im eigenen Land.
Die Menschenrechte sind ein zentraler Bestandteil der europäischen Identität. Die Europäische Union gründet sich auf die Werte der Achtung der Menschenwürde, der Freiheit, der Demokratie, der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit und der Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören (Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union). Diese Werte teilen die Mitgliedstaaten laut Vertrag.
Die Menschenrechte sind von zentraler Bedeutung dafür, wie die Europäer ihre Rolle in der Welt sehen. Die Mitgliedstaaten wollen, dass sich die Union bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene „von den Grundsätzen leiten lässt, die für ihre eigene Entstehung, Entwicklung und Erweiterung maßgebend waren (...): Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Achtung der Menschenwürde, der Grundsatz der Gleichheit und der Grundsatz der Solidarität sowie die Achtung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts.“ (Art. 21, EUV)
Nach dem Völkerrecht haben die Staaten die Pflicht, die Menschenrechte zu achten, zu erfüllen und zu schützen. Sie müssen darauf achten, die Rechte nicht zu verletzen, alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, damit ihre Bürger in den Genuss der Rechte kommen, und Maßnahmen ergreifen, um andere Staaten daran zu hindern, sie zu verletzen. Wie schneidet die EU ab? Das europäische Reglement zu Menschenrechten ist eines der strengsten der Welt.