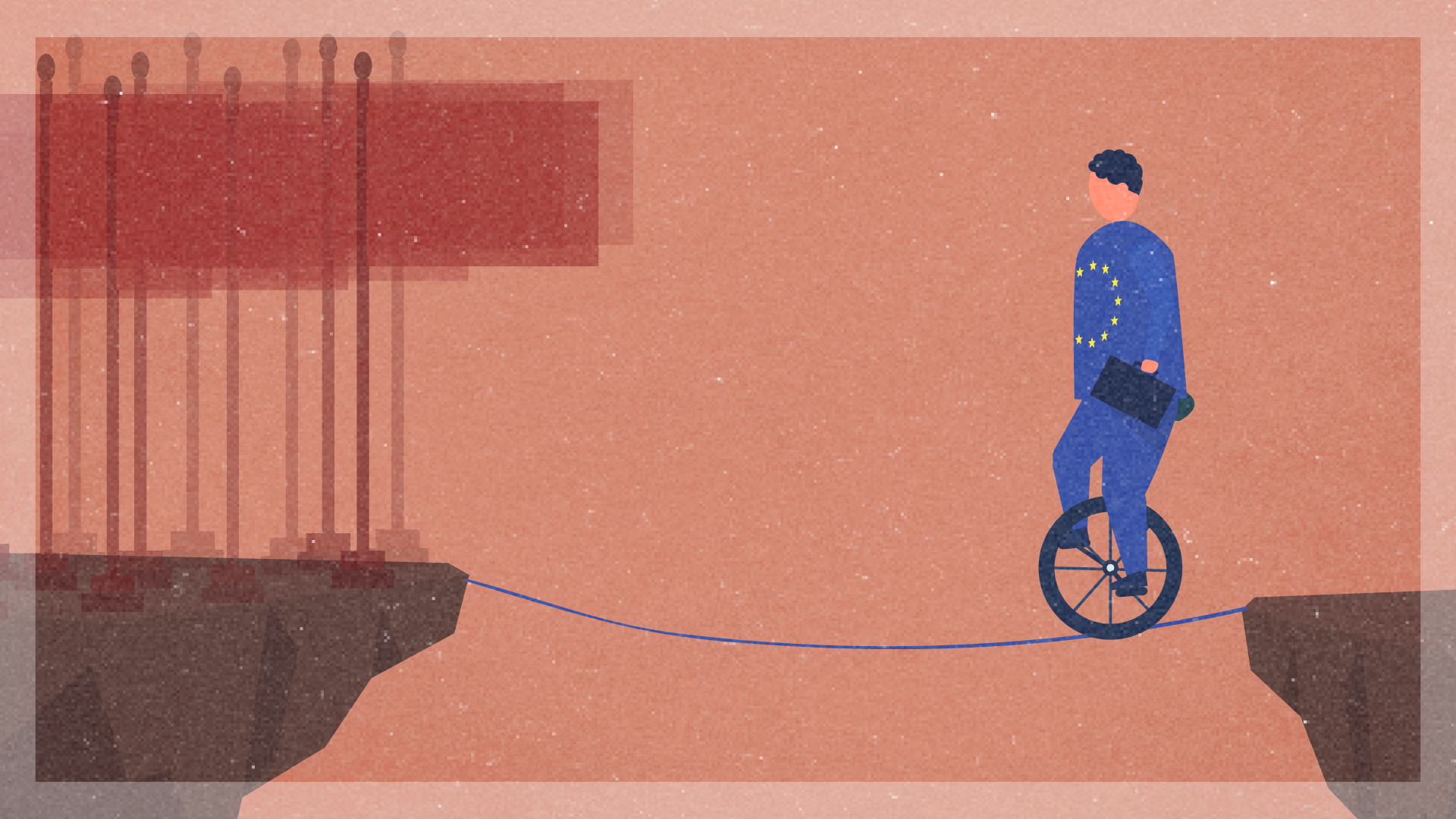Meiner Meinung nach fehlen jedoch noch eine gemeinsame Vision und kreative Vorstellung davon, was dieses Netzwerk leisten kann. EUNIC arbeitet bereits mehr oder weniger erfolgreich in Clustern und entwickelt gemeinsame Projekte, ist aber noch nicht in der Lage, den Mitgliedern die Angst zu nehmen, sie könnten ihre Souveränität, Sichtbarkeit und sogar Identität verlieren, wenn sie sich voll und ganz zu einem europäischen Denken bekennen und sich für europäische Politik und Praxis starkmachen. Jeder kann den Weckruf hören. Wenn EUNIC nicht aus seinen schönen Tagträumen erwacht, verpasst es seine große Chance, die angestrebte Führungsrolle zu übernehmen.
EUNIC sollte es darum gehen, dass Europa vorankommt, dass eine Strategie für ein konsequentes, einfallsreiches, wirksames und nachhaltiges internationales kulturelles Engagement entwickelt und umgesetzt wird. Der Auftrag kann sich nicht darin erschöpfen, gemeinsame Projekte zu koordinieren, ökonomisch zu denken und penetrantes (um nicht zu sagen „aggressives“) europäisches Fundraising zu betreiben, um einen Ausgleich zu den schwindenden Ressourcen auf nationaler Ebene zu schaffen.
Dieses Netzwerk sollte sich vorwärtsbewegen, eine eigene Agenda verfolgen sowie Wissen, Netzwerke und Ressourcen austauschen, um die internationalen Beziehungen aktiver zu beeinflussen – gemäß dem Leitmotiv: „eine Kultur des Teilens als Strategie zur Einflussnahme“. EUNIC sollte gemeinsam europäische politische, kulturelle, bildungsorientierte, institutionelle Themen besprechen und mutig angehen.
Die Globalisierung hat die Kultur stark beeinflusst. Es haben sich neue Anziehungspunkte und Machtzentren gebildet, neue Märkte, Netzwerke, Künstlerkreise und Herangehensweisen.
Als europäische Organisation könnte es beispielsweise den unabhängigen Stimmen in den Gastländern viel stärker beistehen, um international noch mehr wahrgenommen zu werden und Demokratisierungsprozesse zu unterstützen – durch fachkundiges Eingreifen an den Schnittstellen von Kultur und Politik.
EUNIC arbeitet bereits in vielen Ländern mit unterschiedlichen privaten und öffentlichen Partnern in verschiedenen Formaten zusammen. Jetzt sollte es noch einen Schritt weiter gehen und ein Exempel statuieren, wie Europa in der Welt konsequent agieren kann. Dazu gehört, aufmerksam den Ansichten und Erwartungen lokaler Communities zuzuhören, mit politischer und kultureller Sensibilität auf länder- und regionenspezifische Kontexte und Bedürfnisse zu reagieren, über offizielle Kreise hinaus nachhaltige Verbindungen zwischen Fachleuten herzustellen, neue Ideen für Austausch und internationale Zusammenarbeit zu entwickeln und die hybriden Komponenten innerhalb der eigenen Kulturen zu schätzen statt traditionelle kulturelle Bilder und Ausdrucksformen zu „exportieren“.
Darüber hinaus ist es wichtig, in transnationale künstlerische Entdeckungen und Experimente zu investieren, langfristige kreative Prozesse zu unterstützen sowie konsequent ehrlich für Europa Partei zu ergreifen – und damit eine Verbindung zwischen Praxis und Politik zu schaffen. So könnte EUNIC eine inspirierende Plattform werden, die international ein neues Ethos des Teilens und eines wechselseitigen Gebens und Nehmens einführt. Die größten Hindernisse bei der Verwirklichung dieser Vision liegen in der Struktur seiner Mitglieder, der Organisation der auswärtigen Kulturpolitik der EU-Staaten insgesamt sowie in dem Mangel an Entschlossenheit und Begeisterung.
Eine gemeinsame Agenda festzulegen, stellt deshalb eine große Herausforderung dar. Ruth Ur, die Leiterin des Bereichs Kunst und Entwicklung des British Council, stellte im Rahmen der Debatte um „More Europe“ fest: „EUNIC muss immer noch beweisen, dass es mehr ist als die Summe einzelner europäischer Aktionen.
In einer komplexer werdenden globalen Landschaft mit neuen Einflusszentren müssen die EU und ihre Mitgliedstaaten ihr kulturelles Engagement in den verschiedenen Weltregionen neu ausrichten und akzeptieren, dass herkömmliche Hierarchien und Präferenzen infrage gestellt werden.
Wenn EUNIC zu dieser genuin europäischen Plattform für die EU-Außenbeziehungen werden will, braucht es neue Formen von Governance und Führung, Pilotprojekte, um Ideen zu testen, größere Kapazitäten und Ressourcen. Zum jetzigen Zeitpunkt, da die EU mit Entbehrungen zu kämpfen hat und Budgets gestrichen werden, ist ein so weitreichender Ansatz eher unwahrscheinlich.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die globale Machtverschiebung auf die Hervorbringung, Verteilung und Rezeption von Kultur ausgewirkt und eine neue und faszinierende kulturelle Landschaft geschaffen hat. Gleichwohl hat dies noch nicht zu einem größeren Gleichgewicht in kulturellen Austauschprozessen oder zu einer mit besseren Ressourcen ausgestatteten transnationalen und multilateralen kulturellen Kooperation geführt. In Anbetracht dieser Situation kann sich Europa nicht einfach zurücklehnen – nach innen schauen – und darauf warten, dass andere das Ruder übernehmen. Wir müssen uns selbst in den Spiegeln betrachten, die uns andere Regionen vorhalten. Wir müssen auf die Stimmen außerhalb Europas hören, uns Gedanken machen und konsequent und entschieden als Europäer handeln.
Für uns alle ist dies eine Zeit der Herausforderungen – für die EU, für EUNIC, für Netzwerke und an internationalem Austausch beteiligte Akteure der Zivilgesellschaft. Alle sind sich dessen bewusst, dass sie in einer multipolaren Welt ihre eigene unverkennbare Rolle finden sowie neue Partner und Ressourcen auftun müssen, um Gewicht zu haben.
Vor allem aber brauchen wir eine gemeinsame Vorstellung davon, für welches Ziel und welchen gewünschten Effekt Europa mit anderen Kontinenten auf der kulturellen Ebene interagieren will. Eine strategisch angelegte europäische Außenkulturpolitik wird alle diese Partner mit ins Boot holen und nationale Bestrebungen mit europäischen Notwendigkeiten versöhnen müssen – ebenso wie Interessen der Public Policy mit der zivilgesellschaftlichen Praxis. Das Prinzip „Machtverteilung als Strategie der Einflussnahme“ wäre ein intelligenter Weg für die Zukunft. Denn so weiß man das Wissen und die Erfahrungen, die jeder einzelne Partner mitbringt, zu schätzen und respektiert gleichzeitig die Unabhängigkeit des Kultursektors und der Zivilgesellschaft.