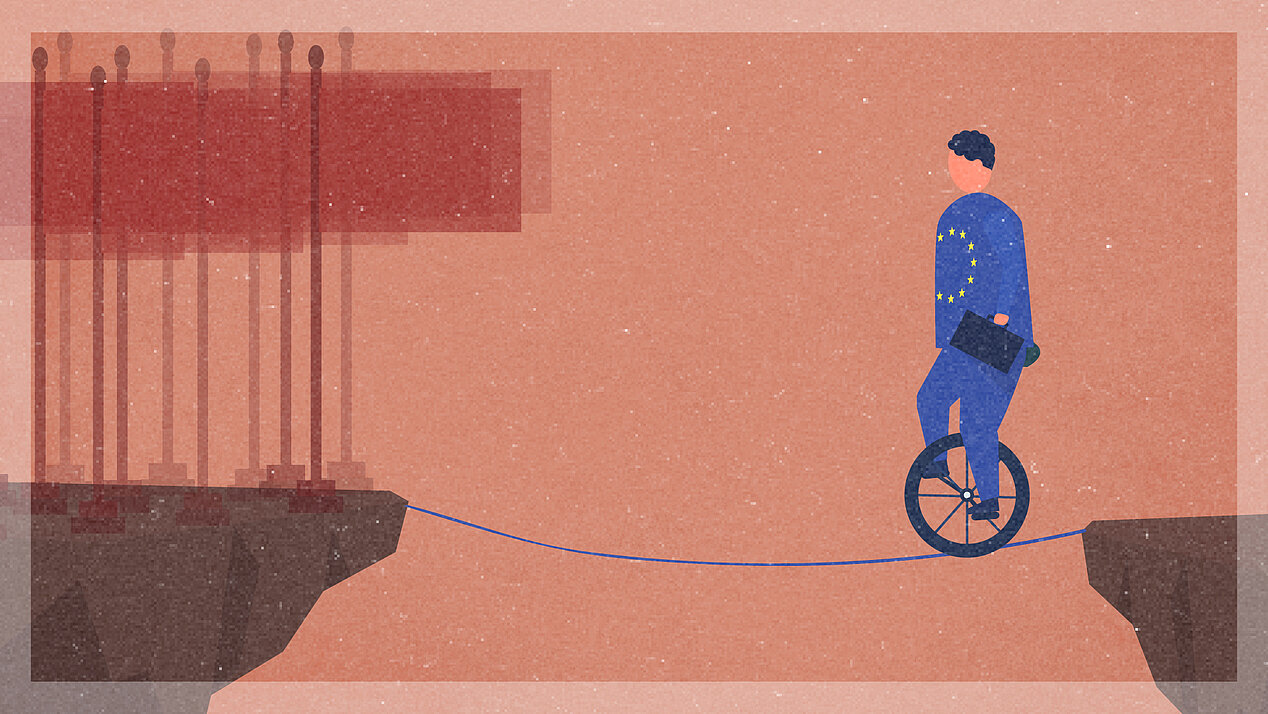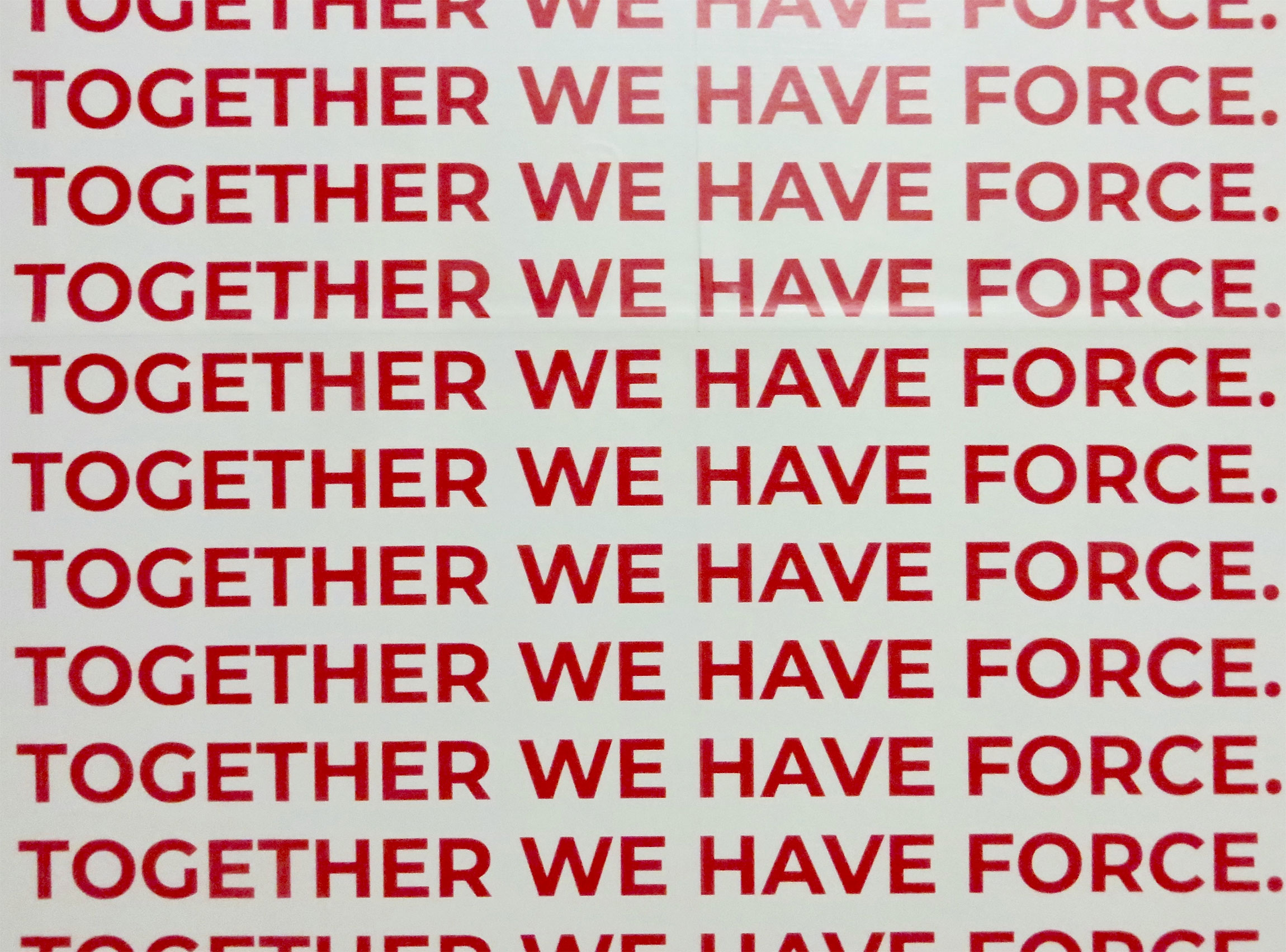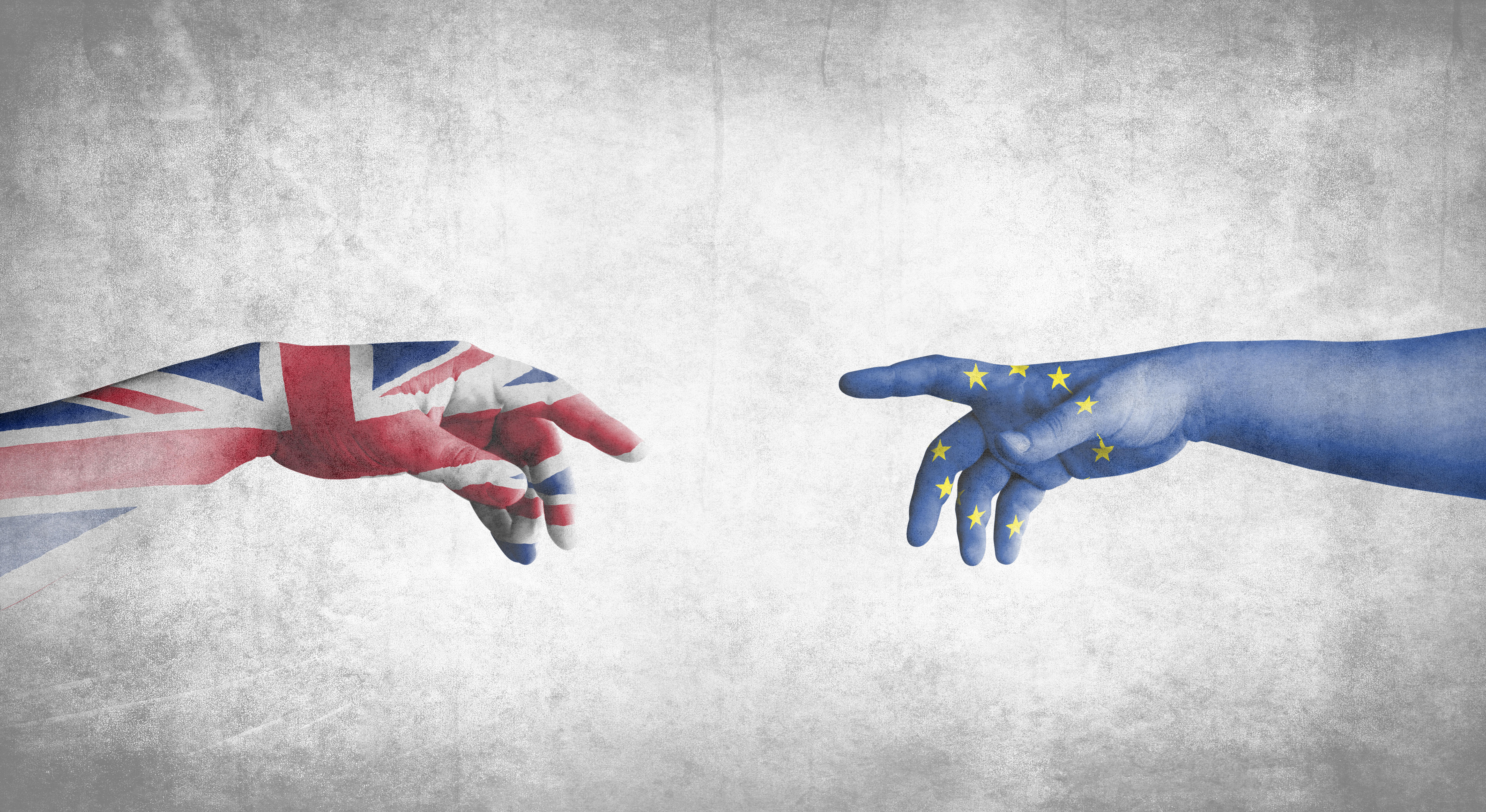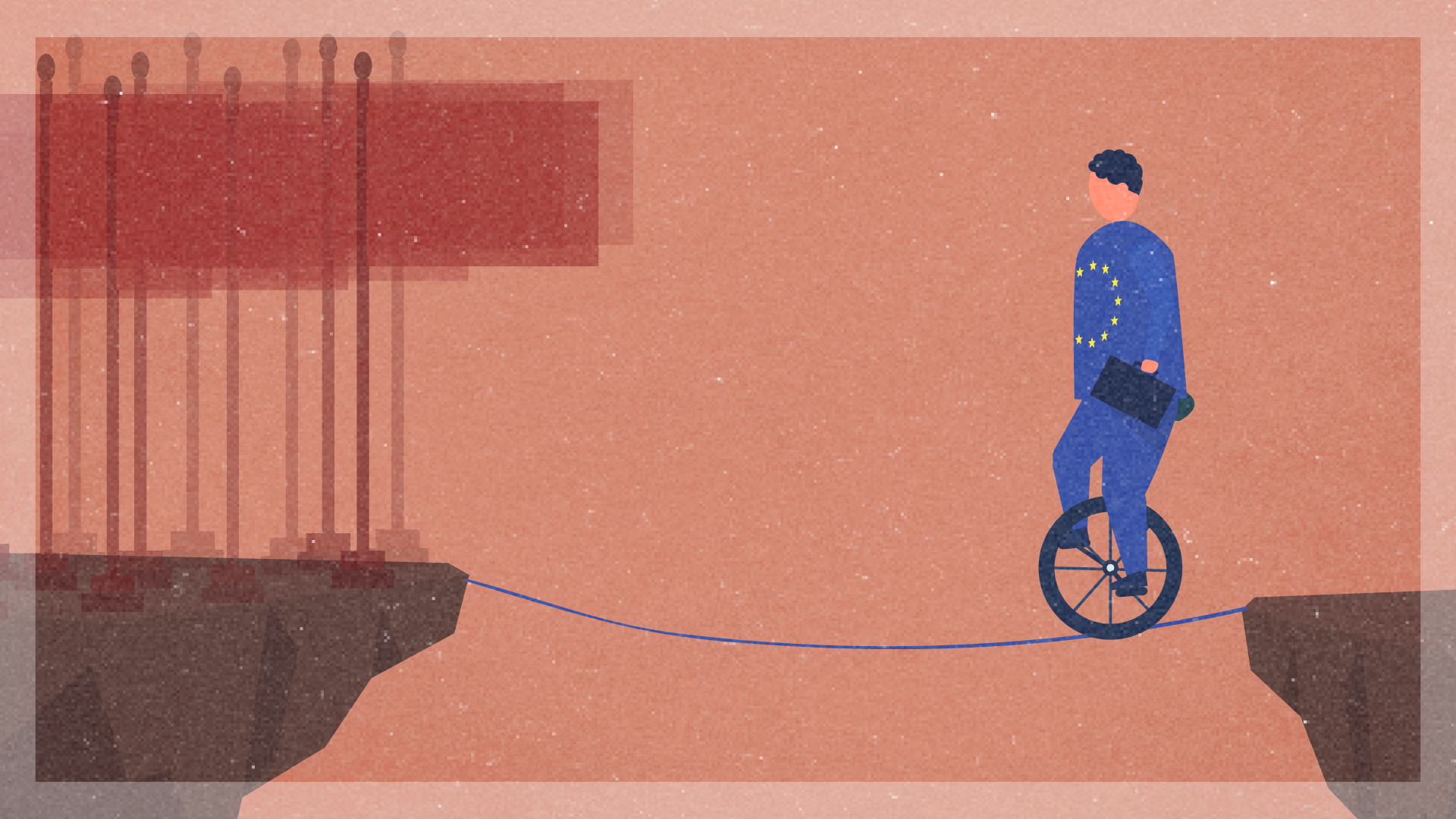Nach Irak und Afghanistan
Die dritte wichtige Entwicklung ist der Richtungswechsel der USA. Die weitgehend erfolglosen Interventionen in Afghanistan und im Irak haben Amerikas Bereitschaft, Gewalt als Instrument der Staatskunst einzusetzen, beeinträchtigt. Auch die Bereitschaft Amerikas, als Hüter des internationalen Handelssystems aufzutreten, hat nachgelassen. Bis zur Wahl Donald Trumps hielten führende Demokraten und Republikaner im Großen und Ganzen an der Rolle Amerikas als Anführer der „freien Welt“ nach 1945 fest.
Trump hat mit dieser Tradition gebrochen. Als Präsident hat Trump die NATO als „veraltet“ bezeichnet (eine Bemerkung, die er zurücknahm) und die EU als „Feind“ (eine Bemerkung, die immer noch gilt). Er hat Diktatoren gelobt und Verbündete, darunter Kanada, Deutschland und das Vereinigte Königreich, verachtet.
Trump verhängte Zölle auf Stahl und Aluminium aus Kanada und Europa, angeblich aus Sicherheitsgründen, die nun von der Regierung Biden wieder rückgängig gemacht wurden. Trump beendete die Teilnahme Amerikas am Pariser Abkommen von 2015 zur Eindämmung des Klimawandels, aber die neue amerikanische Regierung verpflichtet sich erneut dazu. Präsident Trump hat das Nuklearabkommen mit dem Iran aus dem Jahr 2015 aufgekündigt (Präsident Biden ist bereit, die Verhandlungen fortzusetzen) und angekündigt, aus dem INF-Atomwaffenkontrollabkommen mit Russland auszusteigen.
Washington hat dem Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA), das humanitäre Hilfe für die Palästinenser leistet, die Mittel gestrichen. Die USA haben die UNESCO verlassen. Sie haben die Zusammenarbeit mit den UN-Sonderberichterstattern eingestellt, deren globales Mandat auch mögliche Menschenrechtsverletzungen in den USA umfasst.
Wie sollten die Europäer reagieren, wenn Russland Konflikte schürt, China aufsteigt und Amerika als Garant der liberalen Weltordnung möglicherweise unzuverlässig ist?
70 Jahre lang haben Prinzipien und Werte dazu beigetragen, das Atlantische Bündnis, die Welthandelsorganisation und andere Säulen der internationalen Ordnung zusammenzuhalten. Diese Ära, so scheint es, geht nun zu Ende. Wie sollten die Europäer reagieren, wenn Russland Konflikte schürt, China aufsteigt und Amerika als Garant der liberalen Weltordnung möglicherweise unzuverlässig ist?
Zwei Weltkriege und die Entkolonialisierung haben die Stellung Europas als geopolitisches Zentrum der Welt beendet. Mit dem Ende des Kalten Kriegs und dem Zusammenbruch der Sowjetunion verlor Europa auch seinen Platz im Zentrum der amerikanischen Außenpolitik.
Dieser Prozess wird weitergehen. In dem Maße, wie sich andere globale und regionale Machtzentren herausbilden, wird die relative Position Europas unweigerlich schwächer werden. Zunächst einmal wird der Anteil Europas an der Weltbevölkerung sinken. Im Jahr 2015 zählte die EU 509 Millionen Einwohner, was etwa 6,9 Prozent der Weltbevölkerung entspricht. China und Indien (beide jeweils 1,4 Milliarden) machten zusammen 35 Prozent der Weltbevölkerung aus.
Da andere Teile der Welt wachsen, wird der Anteil Chinas voraussichtlich von 18,9 Prozent auf 12,0 Prozent im Jahr 2050 sinken, während der Anteil Indiens von 17,7 Prozent auf 16,1 Prozent zurückgehen dürfte.