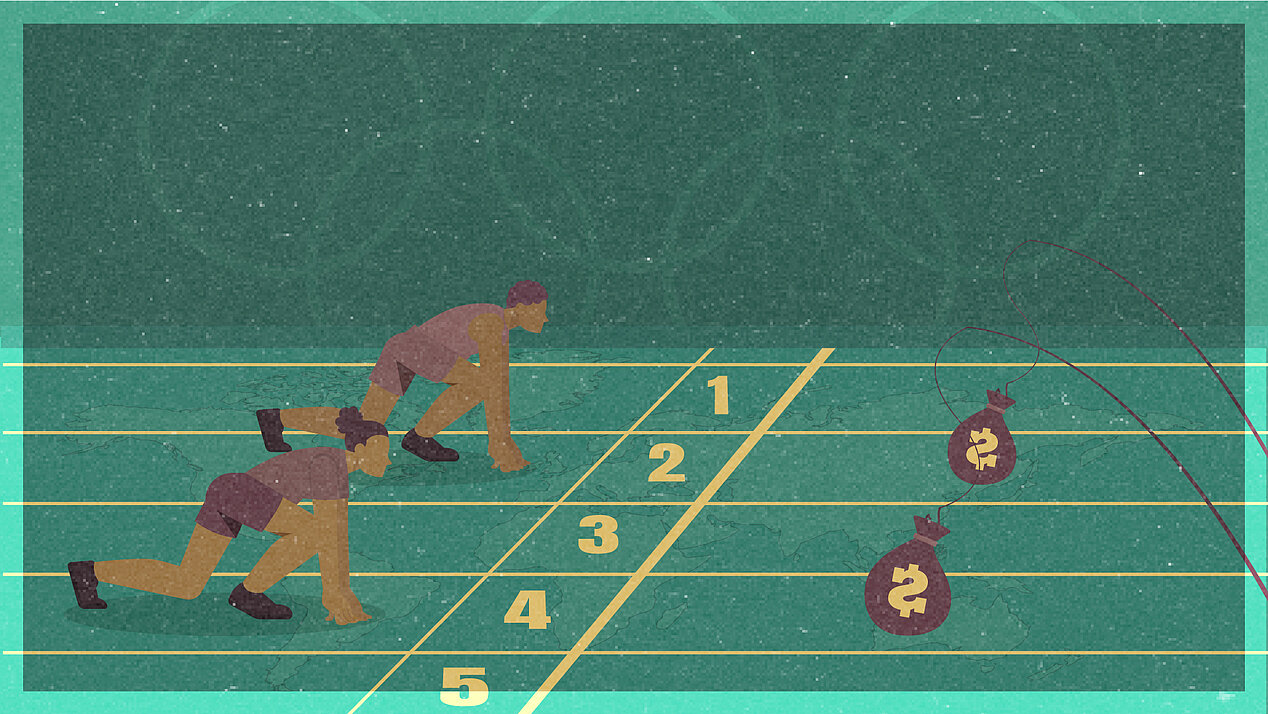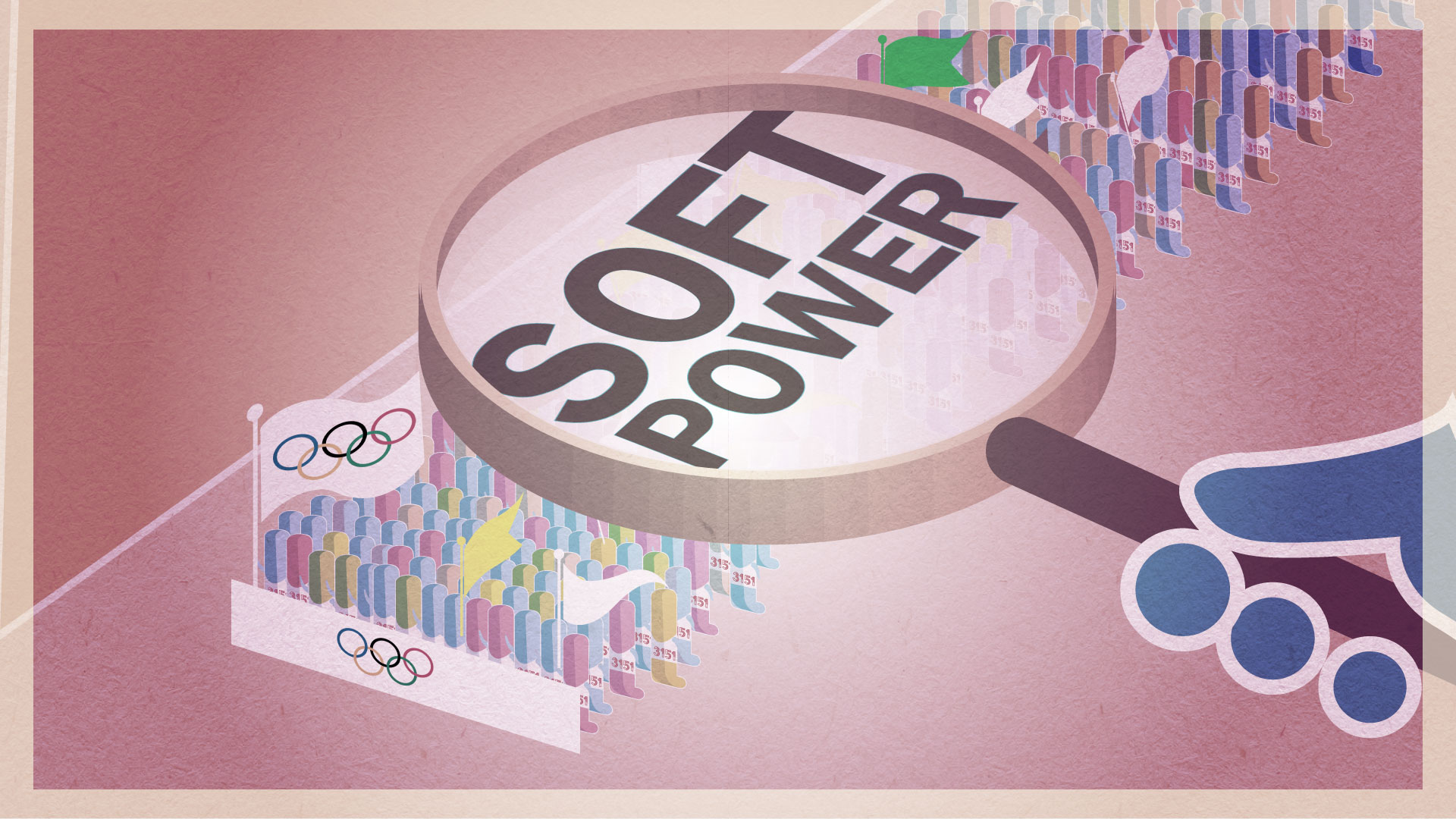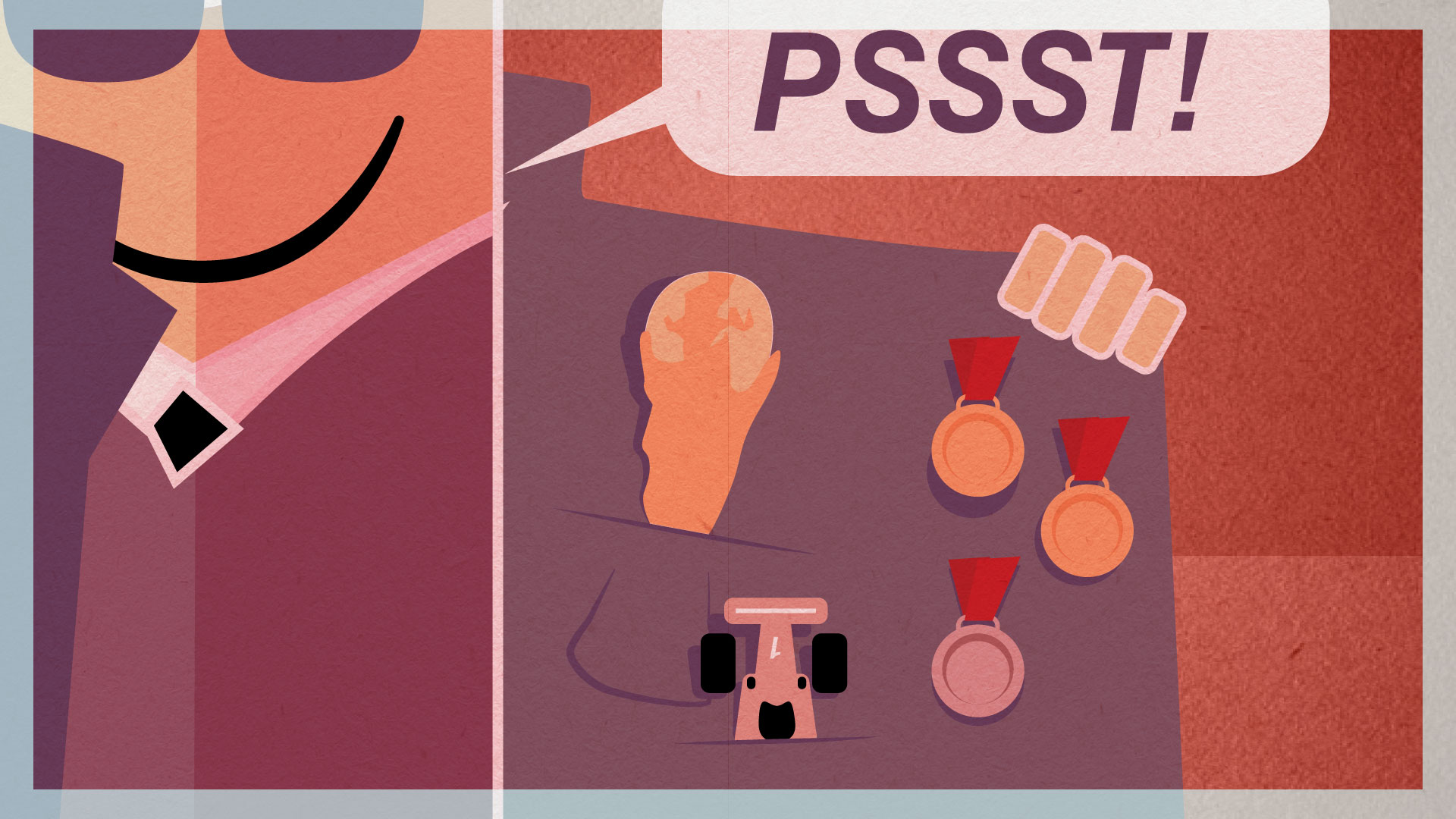Wie es niederländische Kollegen ausgedrückt haben: Ein Medaillenspiegel erzählt keine Geschichten! Das tun nur einzelne Wettbewerbe und Sportler:innen beziehungsweise Mannschaften. Chinesische Sportler:innen sind weiterhin unbekannt, obwohl diese 2008 im eigenen Land doch 100 Medaillen (davon 51 goldene) und Platz 1 im Medaillenspiegel errungen hatten. Eine Geschichte, die hingegen vielen noch bekannt sein dürfte, ist eine des Scheiterns, nämlich jene des Hürdensprinters Liu Xiang, der als Titelverteidiger bereits im Vorlauf verletzungsbedingt ausscheiden musste. Solche „olympischen Momente“, die – über Landesgrenzen hinweg – Emotionen wecken und im Gedächtnis bleiben, kann man sportpolitisch nicht planen, und man kann sie auch nicht einfach aus dem Medaillenspiegel „herauslesen“.
In einer Studie im Jahr 2011 wurde gefragt, ob einzelne Sportler:innen oder ganze Länder bei den vorherigen Olympischen Spielen besonders negativ in Erinnerung waren: China, die Top-Nation von 2008, wurde dabei mit Abstand am häufigsten genannt – wegen Dopingverdachts, aber auch mit der Begründung, insbesondere jüngere Sportler:innen würden instrumentalisiert und zu sehr „gedrillt“.
Damit also sportliche Erfolge zu internationalem Prestige führen, müssen sie zunächst einmal regelkonform erzielt werden. Ob das „auf dem Platz“ der Fall ist, kann man heute dank ausgefeilter Bildtechnik als Zuschauer meist gut nachvollziehen. Ob aber auch „neben dem Platz“, also in Vorbereitung und Training, alles mit rechten Dingen zugeht, ist mangels eines global effektiven Kontrollsystems nur begrenzt nachprüfbar: Für internationale Rezipienten stellt sich mithin die Frage, ob sie einem bestimmten Sportler oder dessen Land und Sportsystem vertrauen. Diese Vertrauensabhängigkeit sportlichen Erfolgs zeigt sich etwa in den Meinungen zum jamaikanischen Sprinter Usain Bolt: In besagter Umfrage war er sowohl der internationale Athlet, an den man sich mit Abstand am häufigsten positiv erinnerte und zugleich der am zweithäufigsten negativ erinnerte – weil eben viele nicht glaubten, dass seine Leistungen „sauber“ erzielt werden konnten.
So finden sich heute in den westlichen Demokratien nicht etwa deshalb so schwer Olympia-Gastgeberstädte, weil die Menschen ... sich vom Sport per se abgewendet hätten ... , sondern weil sie offenbar nicht jenen Sport wollen, für den das IOC steht.
Jedoch ist im Sport, zumal im olympischen, die bloße „Sauberkeit“ meist nur notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung für die Anerkennung von Erfolgen. Denn über formale Regelkonformität hinaus erwarten viele Menschen in vielen Nationen (genauere internationale Daten fehlen…) auch eine Orientierung an informellen Prinzipien der Fairness. Das Attribut „olympisch“ steht – oder stand zumindest dem Anspruch nach einmal (im Grunde ähnlich wie das Fairtrade-Siegel bei Lebensmitteln) – für das Versprechen einer respektvollen, friedlichen, „humanen“ Konkurrenz, in der dem Erfolg eben nicht alle Werte untergeordnet werden sollen.
Und diese Erwartungen erstrecken sich offensichtlich nicht nur auf das Verhalten einzelner Sportler:innen in konkreten Wettkampfsituationen, sondern auch auf die abstraktere Konkurrenz der Nationen untereinander und nicht zuletzt auch auf den Umgang der Sportsysteme bzw. ihrer Funktionäre mit den eigenen Athlet:innen.
Deshalb stoßen sportliche Erfolge bzw. die Ausrichtung sportlicher Großveranstaltungen in einigen Ländern mit zweifelhaften Regimen eben nicht auf ungeteilte internationale Begeisterung, solange gewisse Standards nicht gewahrt werden.