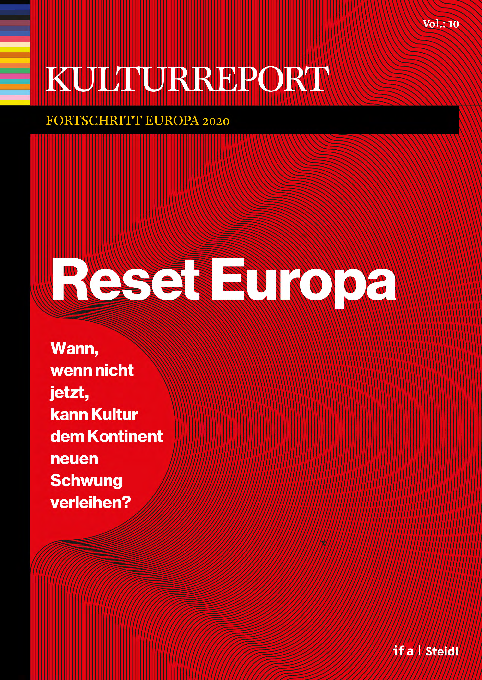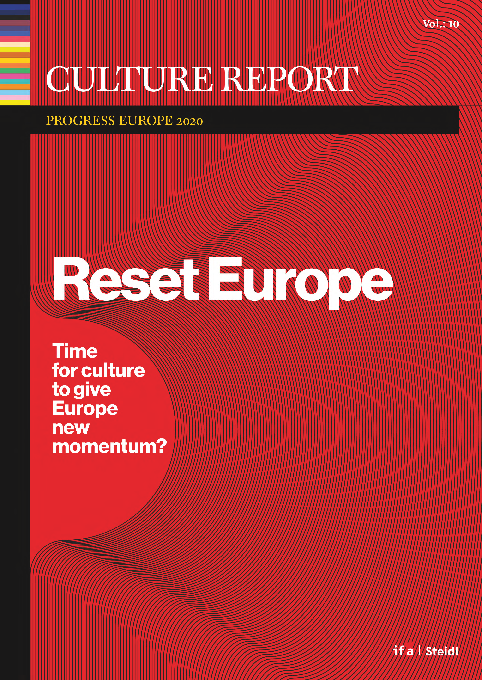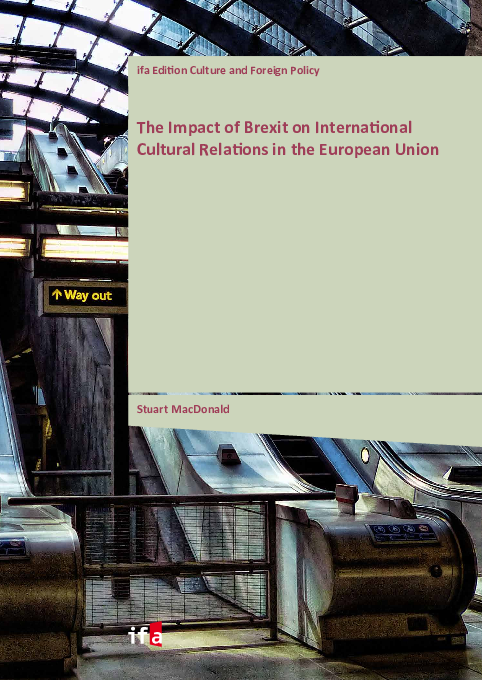Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl als Gegenmittel zu nationaler Identität
Auf dem Spiel steht nicht weniger als die Erhaltung der liberalen Demokratie selbst. Der gegenwärtige europäische Kampf um die nationale Identität begann mit den Initiatoren der Europäischen Union Robert Schuman und Jean Monnet, die eingesehen hatten, dass den beiden Weltkriegen, die der Kontinent durchgemacht hatte, exklusive ethnische Definitionen nationaler Identität zugrunde lagen.
Als Gegenmittel schufen sie 1951 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, deren Mitglieder Frankreich, Belgien, Westdeutschland, Italien, die Niederlande und Luxemburg waren, mit dem Ziel, die deutsche Wiederaufrüstung zu verhindern und zugleich Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit in einer ehemals integrierten, doch vom Krieg auseinandergerissenen Region zu erleichtern.
Die Möglichkeit, dass Deutschland und Frankreich, die beiden Hauptwidersacher der Weltkriege, einander jemals wieder bekämpfen, ist heutzutage verschwindend gering. Viele junge, zumeist gut ausgebildete Europäer werden inzwischen in einem der Mitgliedstaaten geboren, haben in einem anderen studiert, jemanden aus einem dritten Land geheiratet und arbeiten an verschiedenen Orten innerhalb und außerhalb der Union. Sie bleiben sich ihrer durch Geburt erworbenen Staatsbürgerschaft bewusst, doch ihr Leben ist mit der EU als Ganzem verbunden.
Nationale Symbole wie Flagge und Hymne wurden recht spät eingeführt, und in den EU-Staaten gab es keine einheitliche politische Bildung.
Ob „Europa“ jedoch eine Identität hat, die stärker ist als die alten nationalen Varianten, die sie ablösen sollte, bleibt unklar. In den ersten Jahrzehnten der EU war es politisch nicht akzeptabel, die nationale Identität individueller Mitgliedstaaten lärmend zu feiern. Das galt in erster Linie für Staaten wie Deutschland und Spanien, die eine rechtstotalitäre Vergangenheit hatten: Bürger schwenkten keine Fahnen, sangen keine Nationalhymnen und jubelten nicht zu laut für ihre Nationalmannschaften.
Für sie war Europa eine Zuflucht, nicht unbedingt ein begehrtes Ziel. Die EU war nicht in der Lage, energisch auf eine neue Identität hinzuarbeiten. Sie schuf keine einheitliche europäische Staatsangehörigkeit; Einbürgerungsvorschriften blieben den einzelnen Mitgliedsländern überlassen. Nationale Symbole wie Flagge und Hymne wurden recht spät eingeführt, und in den EU-Staaten gab es keine einheitliche politische Bildung.
Das wichtigste Versäumnis betrifft jedoch die demokratische Verantwortlichkeit der EU selbst. Ihr mächtigstes Organ ist die Europäische Kommission, ein nicht gewähltes technokratisches Gremium, das sich auf die Förderung eines Binnenmarktes unter den Mitgliedern konzentriert. Die Kommission ist den Bürgern nur indirekt rechenschaftspflichtig, nämlich über den Ministerrat, der die EU-Staaten repräsentiert. Das direkt gewählte Europäische Parlament hat sehr beschränkte Befugnisse und bringt deshalb keine nennenswerte Wahlbeteiligung oder Begeisterung hervor.
Die EU-Bürger wissen, dass die entscheidenden Stimmen weiterhin auf Staatsebene abgegeben werden, und dorthin richten sich die meisten ihrer Energien und emotionalen Bindungen. Infolgedessen empfinden sie kaum ein Gefühl der Teilhabe oder Kontrolle über die Institutionen, die Europa als Ganzes lenken. Während die Eliten von einer „immer engeren Union“ sprachen, lungerten die Gespenster der einstigen nationalen Identitäten in Wirklichkeit weiterhin herum wie unerwünschte Gäste auf einer Dinnerparty. Das galt vor allem für ältere, weniger gebildete Wähler, die sich die Freizügigkeit des neuen Europa nicht zunutze machen konnten oder wollten. Solche Gespenster erscheinen zu kritischen Zeitpunkten und sind eine existenzielle Bedrohung für die gesamte EU.
Dies wurde besonders deutlich während der Eurokrise, die durch die immensen Kredite ausgelöst wurde, welche die griechische Regierung während der Boomjahre nach der Jahrtausendwende aufgenommen hatte. Die Deutschen, die durchaus bereit waren, ihre weniger wohlhabenden Mitbürger mit Hilfe eines ausgedehnten Sozialstaats zu unterstützen, zeigten sich weniger großzügig den Griechen gegenüber, als diese drohten, ihre Schulden nicht zu bezahlen.
Die EU-Bürger wissen, dass die entscheidenden Stimmen weiterhin auf Staatsebene abgegeben werden, und dorthin richten sich die meisten ihrer Energien und emotionalen Bindungen.
Tatsächlich hatte man in Griechenland eine ganz andere Einstellung zu Ersparnissen, Darlehen und Vetternwirtschaft im öffentlichen Sektor als in Deutschland. Berlin, der Hauptgläubiger der Griechen, konnte, unterstützt von Institutionen wie der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds, Athen eine vernichtende Austerität auferlegen – eine Situation, die bis in die Gegenwart andauert.
Die Eurokrise enthüllte eine tiefe Kluft zwischen den nördlichen und südlichen Mitgliedern der Eurozone, die sich ihrer nationalen Unterschiede heutzutage viel bewusster sind als vor dem Ausbruch der Krise.