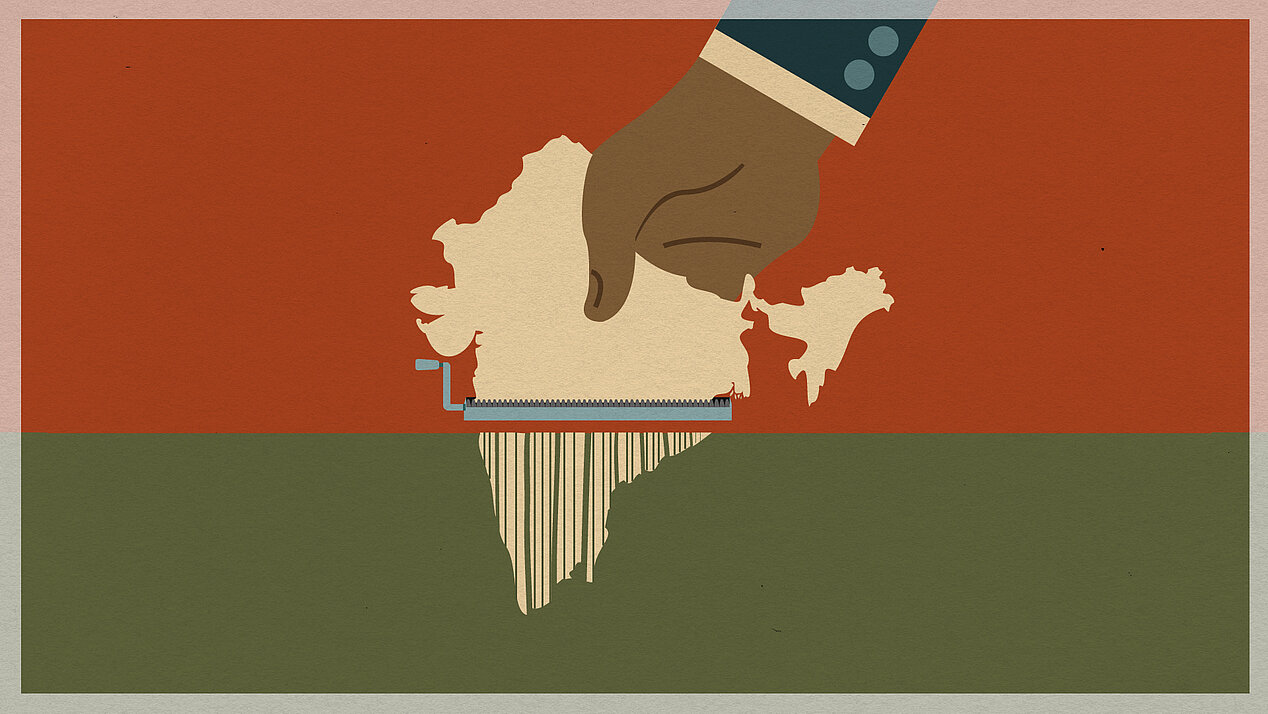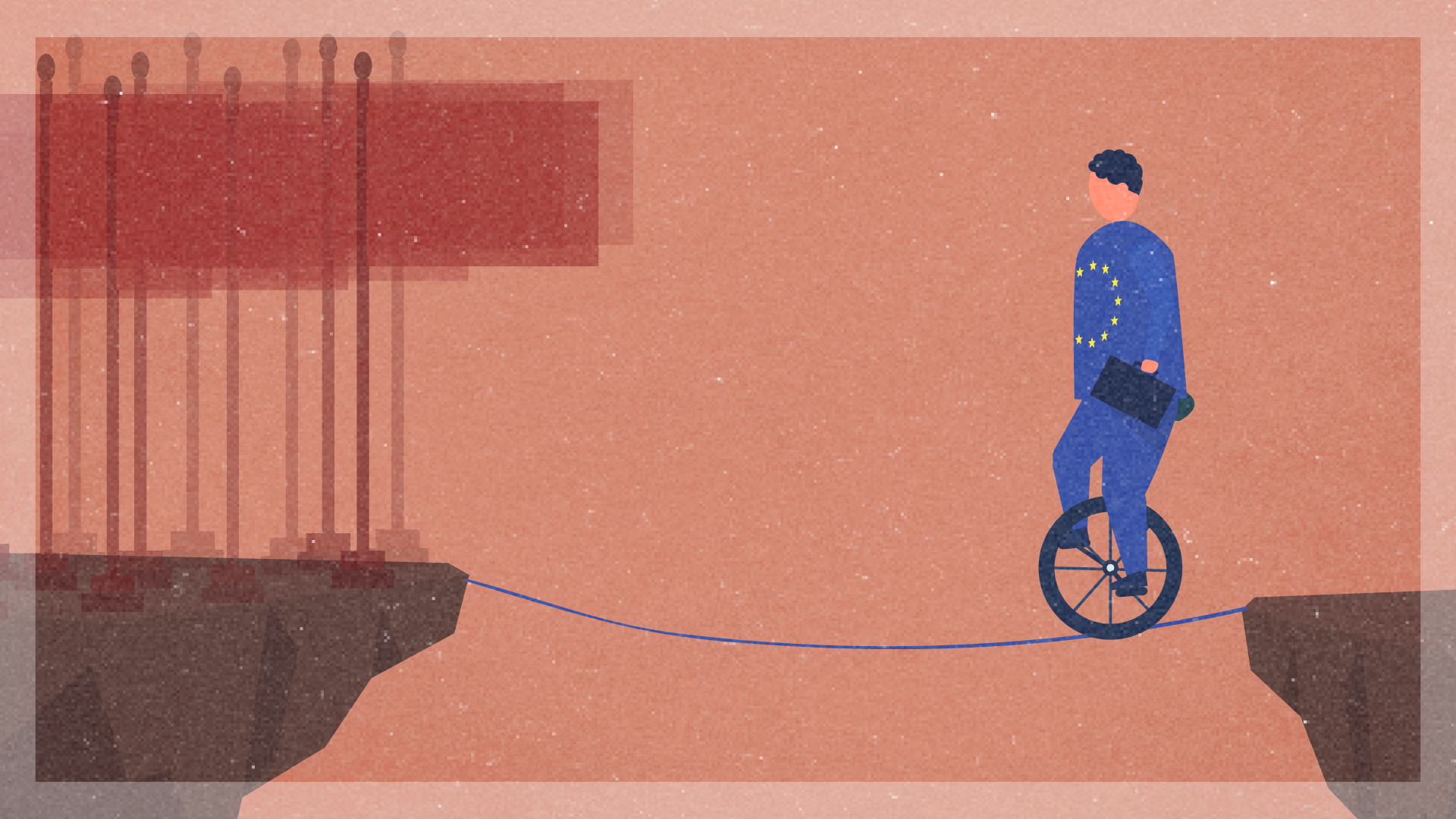Narrative des Narzissmus
In noch jüngerer Zeit und mit noch verheerenderen Folgen hat ein von der politischen Klasse und der Mainstream-Intelligenz Angloamerikas durchgeführtes Experiment in ökonomischem Hyperliberalismus in beiden Ländern dazu beigetragen, neofaschistische Bewegungen und Einzelpersonen zu stärken. Ob China sein demokratisches Defizit beheben wird, wie Südkorea und Taiwan dies taten, ist ungewiss. Seine erschreckend einfallsreiche Unterdrückung der Opposition in Hongkong und Xinjiang erneuert die aus der Geschichte Deutschlands und Japans bekannte Warnung: dass die Biomacht des modernen Staates monströse Verbrechen hervorzubringen vermag.
Chinas Wirtschaftswachstum wurde begleitet von einer beispiellosen Schädigung der Umwelt und grausamen Beschränkungen der individuellen Freiheit.
Es führt dennoch kein Weg an der desolaten Position vorbei, in der die großen Vorbilder der Demokratie sich heute befinden. Weder Großbritannien noch die USA scheinen fähig zu sein, mit der gewaltigen Gefahr für die kollektive Sicherheit und Wohlfahrt fertigzuwerden, die das Coronavirus darstellt. Nicht weniger niederschmetternd ist die Erkenntnis, nun da das Rhodes-Denkmal endlich fällt, dass Macht und Ansehen Angloamerikas in fürchterlichen Grausamkeiten gründeten. „Das Land der Freiheit, wie es sich großsprecherisch nannte, obwohl die Sklaverei in seinem Innersten thronte“, so schrieb der US-amerikanische Psychologe und Philosoph William James 1895, sei in Wirklichkeit immer „etwas Falsches“ gewesen und habe „einen furchtbaren inneren Widerspruch“ enthalten.
Die moralisierende Geschichte der modernen Welt, die ihre frühen Gewinner schrieben – die vielen Von-Plato-zur-Nato-Erzählungen vom weltweiten Florieren der Demokratie, des liberalen Kapitalismus und der Menschenrechte –, bedarf längst einer gründlichen Revision. Mindestens müsste sie auch die Erfahrungen der erst spät entwickelten Nation berücksichtigen: ihr schwieriges und oft tragisches Streben nach ernsthafter Souveränität, ihre verächtlich abgetanen Vorstellungen über eine egalitäre Weltordnung – und die erlösenden Visionen sozialer Bewegungen, von den Grünen in Deutschland bis hin zu den Dalits in Indien.
Die jüngste Explosion politischen Demagogentums nach Jahren endloser und vergeblicher Kriege hätte eine Gelegenheit sein müssen, die Narrative des britischen und US-amerikanischen Narzissmus zu hinterfragen. Trump und der Brexit boten eine Chance, „den Bann der Demokratie zu brechen“, der auf dem angloamerikanischen Denken lag.
Die Übernahme hoher Staatsämter in London und Washington durch Demagogen führte zu einer Flut selbstmitleidiger und selbstschmeichelnder Darstellungen.
Dafür setzte sich der Politiktheoretiker John Dunn seit den späten 1970er Jahren ein, lange bevor der angloamerikanische Triumphalismus vollends erstarrte. Diejenigen, die sich von dem Wort hypnotisieren ließen, so Dunn, übersähen, dass die politischen und ökonomischen Arrangements, die sie bevorzugen und als „Demokratie“ bezeichnen, weder unendlichen Bestand haben könnten noch die „unmittelbaren Probleme des kollektiven Lebens innerhalb der einzelnen Länder und zwischen ihnen effektiv“ zu lösen vermöchten, nicht einmal in der Gegenwart.
Die Übernahme hoher Staatsämter in London und Washington durch Demagogen führte zu einer Flut selbstmitleidiger und selbstschmeichelnder Darstellungen, die beschrieben, wie der lange Marsch der „liberalen Demokratie“ von pöbelhaften „Populisten“, „Identitätsliberalen“, „Social-Justice-Kriegern“ und sogar von hochrangigen Republikanern gestört worden sei, die ihre „Ideale“ und „Prinzipien“ aufgegeben hätten, wie die Publizistin Anne Applebaum in einem Leitartikel im Atlantic schrieb.
Mark Lillas absurde, erstmals in der New York Times aufgestellte Behauptung, die „Mau-Mau-Taktik“ der Black-Lives-Matter-Bewegung und Hillary Clintons „Diversitätsrhetorik“ hätten Trump bei den Wahlen geholfen, wurde ehrfürchtig von der Financial Times und dem Guardian aufgegriffen. Mainstream-Zeitschriften auf beiden Seiten des Atlantiks machten sogleich gegen eine wiederbelebte Linke mobil, indem sie intellektuellen Trickbetrügern und lautstarken Kulturkämpfern eine Bühne boten, während sie verstärkt ihre dem Establishment gewogenen Rückzugspositionen bezogen.
„Die New York Times ist für den Kapitalismus“, versicherte deren Redaktionsleiter James Bennet seinen Kollegen, denn der sei „das größte Armutsbekämpfungsprogramm und die größte Fortschrittsmaschine, die wir jemals gesehen haben“. Bennet hatte in seinem Blatt Artikeln Raum gegeben, die den Klimawandel leugneten, sich für Eugenik einsetzten und für Palästina eine Politik der Apartheid und der ethnischen Säuberung empfahlen. 2020 musste er wegen eines Leitartikels zurücktreten, der den Einsatz des Militärs gegen antirassistische Demonstranten forderte.