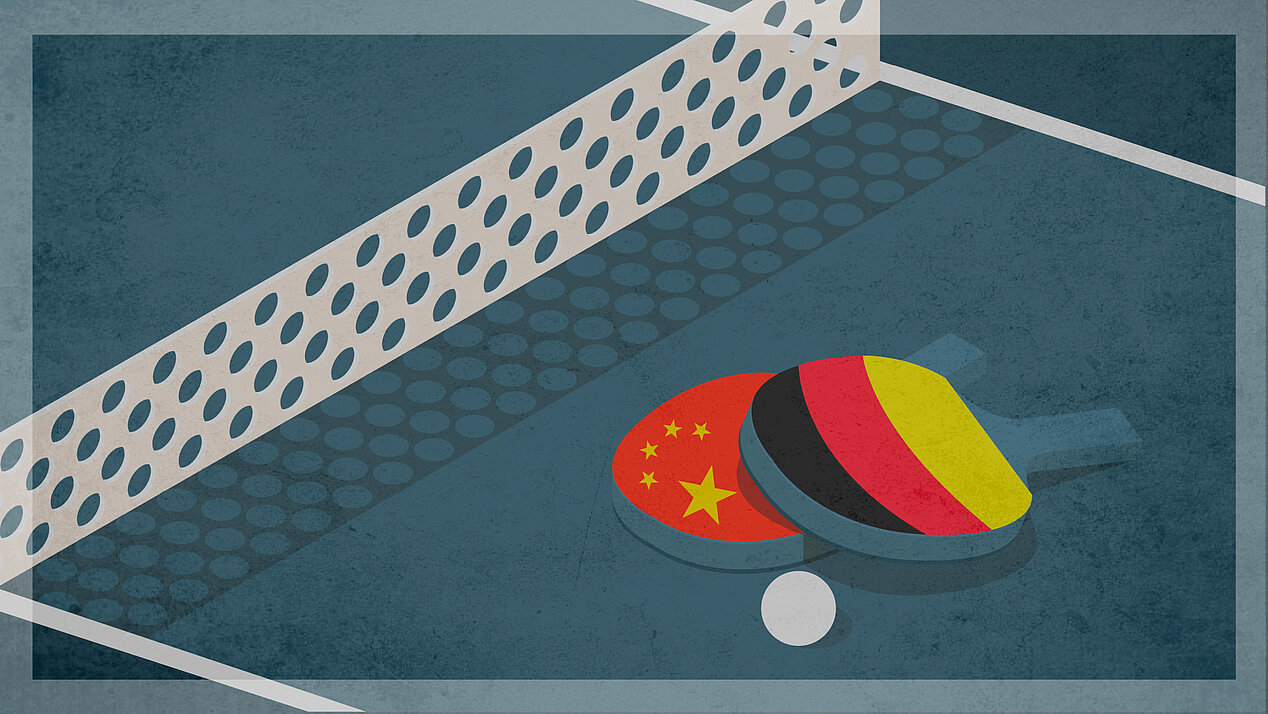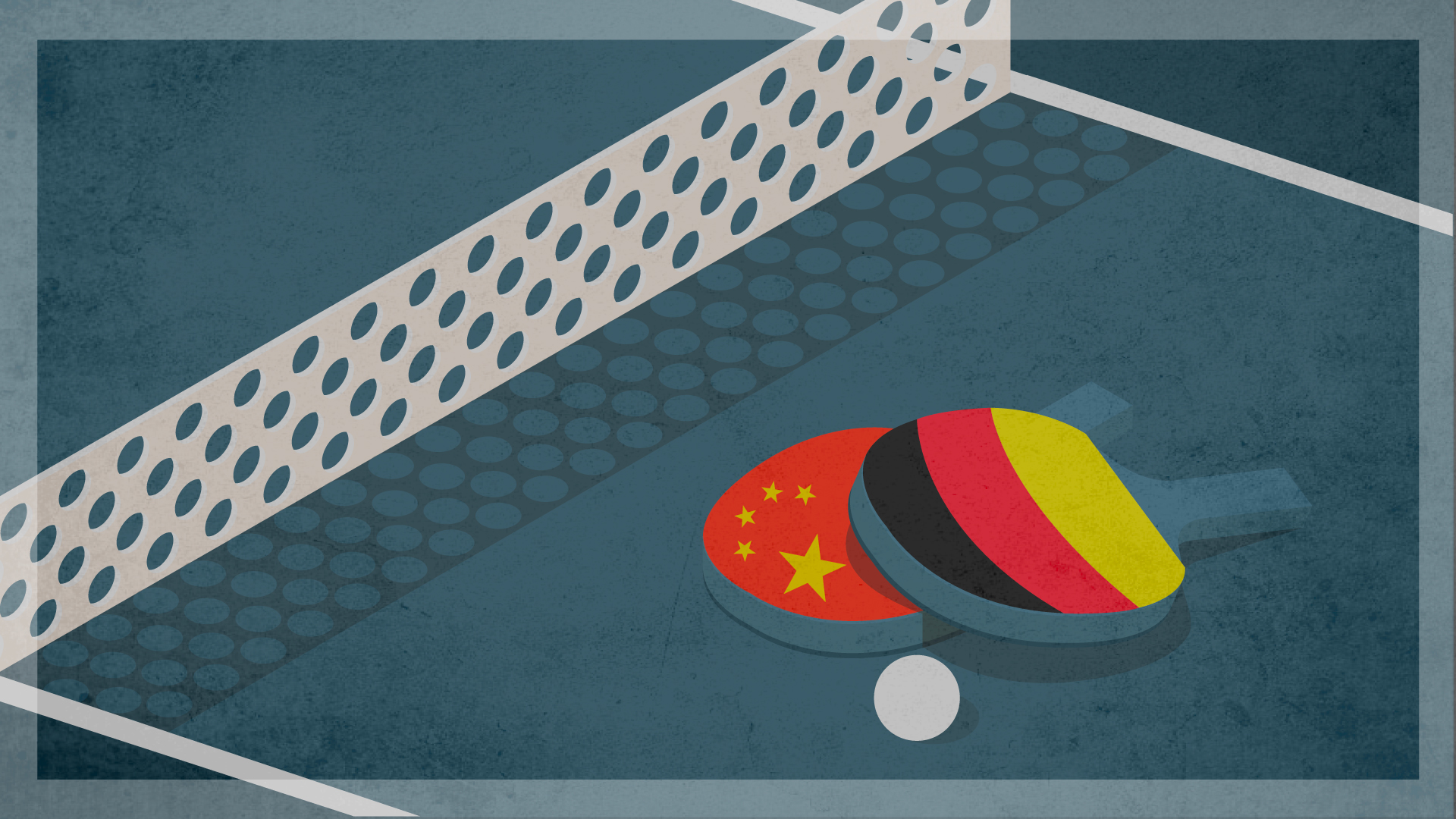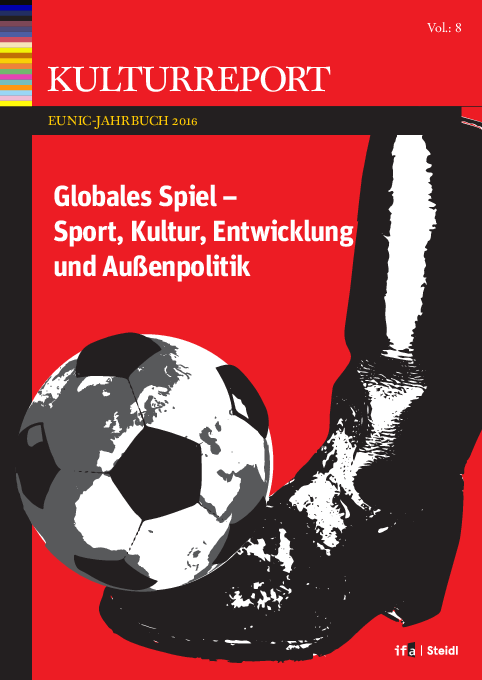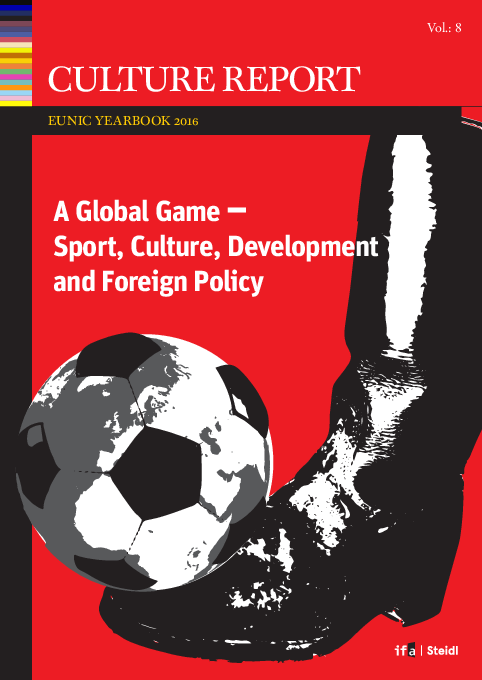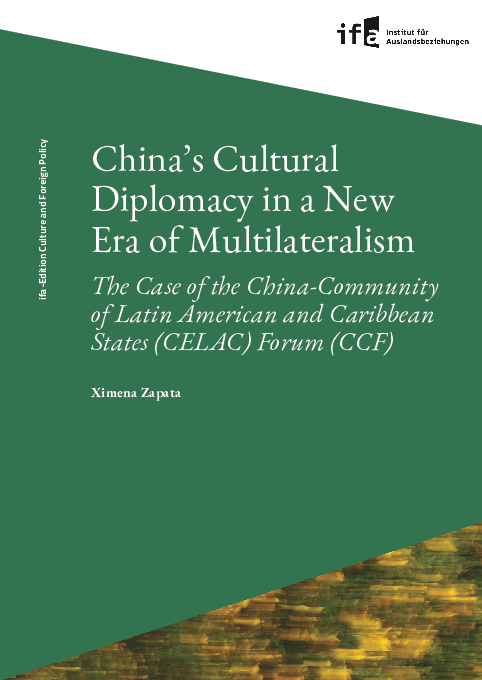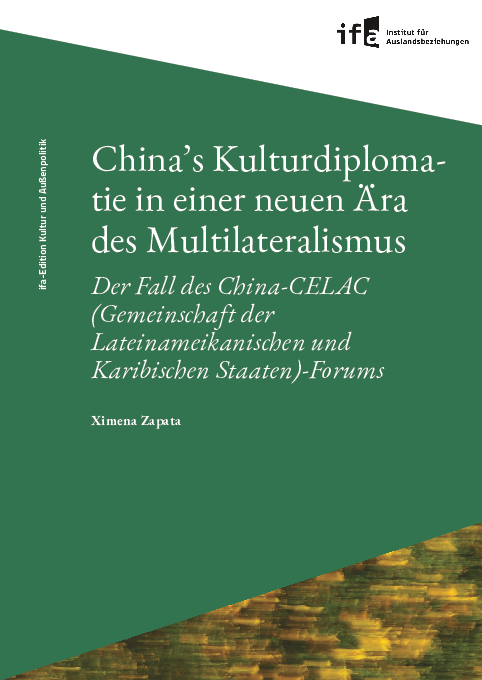Ein Chinesisch-Lehrer brachte mir die alte chinesische Weisheit bei: „Der erste Schritt ist stets der Beginn einer großen Reise.“ Ein solcher Schritt war für Deutschland und China die im April 2008 zwischen dem deutschen Innenministerium und der Generalverwaltung des Sports der Volksrepublik China unterzeichnete „Gemeinsame Absichtserklärung über die Zusammenarbeit im Sport“. Auch wenn es außer Zweifel steht, dass der Sport und die Sportpolitik zwischen Staaten Barrieren abbauen und einen Beitrag zur Entspannung und zum Frieden leisten können: Im Jahre 2007 gab es massive nationale und internationale kritische Stimmen zur Durchführung der Olympischen Spiele in Peking. In europäischen Städten, unter anderem in Frankreich, hingen chinakritische Spruchbänder und Plakate. Den Höhepunkt erreichten chinakritische Äußerungen mit den Forderungen, unter anderem des damaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Hans Gert Pöttering, der mit einem europäischen Boykott der Olympischen Spiele in China drohte, und darüber hinaus China zu Gesprächen mit dem Dalai Lama aufforderte.
Der damalige deutsche Innenminister Wolfgang Schäuble ließ sich von diesem Szenario nicht beeindrucken und setzte darauf, dass man durch eine zielgerichtete sportpolitische, bilaterale Zusammenarbeit Brücken bauen kann, die der gegenseitigen Verständigung dienlicher sind als Boykottaufrufe. Als der chinesische Sportminister Liu Peng Mitte 2007 Deutschland bereiste, kam es zu einem offiziellen Treffen zwischen ihm und Wolfgang Schäuble. Ich hatte die Chance, einige Tage die chinesische Delegation zu begleiten. Meinem Vorschlag, ein gemeinsames Abkommen zu entwerfen, stimmte Liu Peng sofort zu und bereits kurze Zeit später stand der Text.
Noch vor Beginn der Olympischen Spiele reiste Innenminister Schäuble – der Zeitpunkt „vor“ den Spielen war ihm wichtig, um die daraus resultierende Dynamik zu nutzen – mit einer entsprechenden Delegation zu sportpolitischen Konsultationen nach Peking. Das dort unterzeichnete Papier mit China ist das bislang einzige von einem deutschen Bundesinnenminister unterzeichnete Abkommen mit einem ausländischen Staat auf dem Gebiet des Sports. In diesem Dokument– wie es übrigens auch bei sonstigen Vereinbarungen des deutschen Innenministeriums mit ausländischen Staaten der Fall ist – das völkerrechtlich gesehen den Charakter eines „Memorandum of Understanding“ hat, unterstreichen beide Seiten, den Austausch und die Zusammenarbeit im Bereich des Sports auf der Grundlage der gegenseitigen Achtung, Gleichberechtigung und zum gegenseitigen Nutzen sowie unter Achtung der Menschenrechte und des olympischen Geists zu entwickeln.
Unmittelbar nach Unterzeichnung der „Gemeinsamen Absichtserklärung“ erfolgten nunmehr in rascher jährlicher Abfolge in den Jahren 2009, 2010, 2011 und 2013 jeweils von Deutschland und China gemeinsam finanzierte Kongresse, Symposien oder Workshops.
Unter dem Leitmotiv „Der Sport verbindet unsere Staaten“ fand im November 2009 an der Bejing Sport University die erste gemeinsame Veranstaltung statt. Wolfgang Schäuble wies in seinem damaligen Grußwort darauf hin, dass dieses Symposium den Grundstein für einen vollständig neuen Abschnitt der sportpolitischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China gelegt habe.
Der Sport wurde häufig als Profilierungsmaßnahme ideologischer Gesellschaftssysteme benutzt.
Ein weiterer Meilenstein einer auf Frieden und Annäherung gerichteten bilateralen Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland war der allererste „Deutsch-Chinesische Sportrechtskongress“ im Oktober 2010 in Bonn. Durch seine international ausgerichtete Besetzung mit Teilnehmern aus China, Deutschland, Belgien, der Schweiz und sogar den USA und seitens der EU-Kommission, wurde er zu einem Erfolg der internationalen sportpolitischen Zusammenarbeit.
Oftmals verlaufen solche Kooperationen mit befreundeten Staaten nach einiger Zeit im Sande. Bei der Volksrepublik China war das nicht der Fall. Etliche sportpolitische Symposien fanden in den folgenden Jahren statt. Dieser Austausch ist deshalb bedeutsam, weil der Sport und die Sportpolitik in einem intensiven Austauschverhältnis zu vielen gesellschaftlichen Bereichen stehen. Hervorzuheben sind hier die Interdependenzen zur Politik, Ökonomie, den Medien und auch zum Bildungssystem. Und ja, der Sport steht in einem ambivalenten Verhältnis zu Frieden und Gewalt. Wie die Geschichte belegt, wurde der Sport häufig als Profilierungsmaßnahme ideologischer Gesellschaftssysteme benutzt.
Im Kalten Krieg wurde der Klassenkampf von der militärischen Ebene in das Stadion gebracht. Ein „sportliches Wettrüsten“ fand statt. Der Kampf um politische Differenzen wurde mit anderen Mitteln und auf anderen Bühnen fortgesetzt.