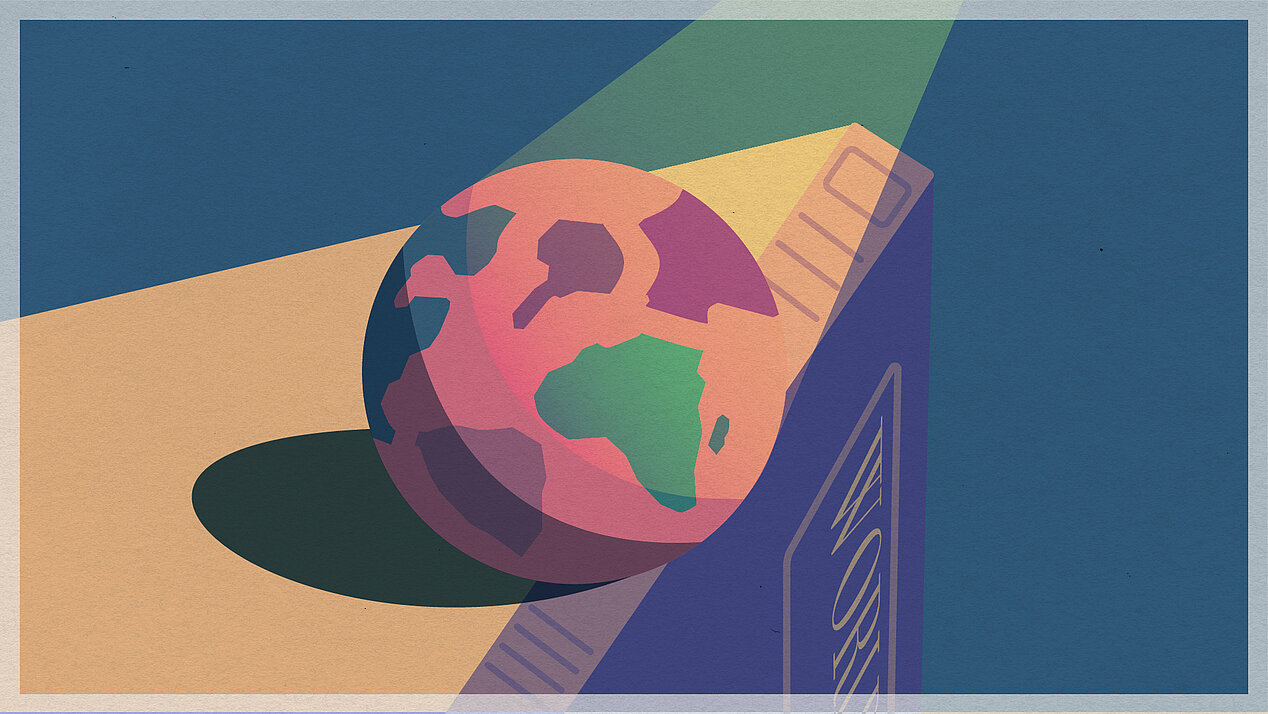Verbannung aus der Domäne ernster Literatur
Im selben Geiste muss aus meiner Sicht aber auch die Frage gestellt werden: Was hat der Klimawandel an sich, dass allein schon seine erzählerische Erwähnung zur Verbannung aus den Domänen ernster Literatur führt? Was sagt uns das über die Kultur und ihre Vermeidungsmuster?
Wenn die Welt sich schließlich substanziell verändert hat, wenn der Anstieg der Meeresspiegel etwa die Sundarbans, die größten Mangrovenwälder der Erde, verschluckt und Städte wie Kolkata, New York und Bangkok unbewohnbar gemacht hat5 und die Leser oder Museumsbesucher sich der Literatur und den bildenden Künsten unserer Zeit zuwenden – werden sie dann nicht als Erstes nach den Spuren und Vorzeichen für die verwandelte Welt suchen, die sie von uns geerbt haben?
Und wenn sie keine finden, zu welchem anderen Schluss sollten – könnten – sie dann kommen als dem, dass die meisten künstlerischen Ausdrucksformen unserer heutigen Zeit in den Sog der Verschleierungsmethoden geraten waren, die uns daran hinderten, die Realitäten unserer Misere zu erkennen? Insofern ist es doch sehr wahrscheinlich, dass unsere Ära, die sich so gerne ihrer Selbsterkenntnis rühmt, als die Zeit der Großen Verblendung6 in die Geschichte eingeht.
Es könnte natürlich gar nicht anders sein: Wären Romane nicht von einem Grundgerüst außergewöhnlicher Momente gestützt, stünden Schriftsteller vor der Aufgabe, die Welt in ihrer Gesamtheit abzubilden, so wie Jorge Luis Borges es in seinen Werken tat. Doch im Gegensatz zur Geologie war der moderne Roman nie gezwungen, sich der zentralen Bedeutung des Unwahrscheinlichen zu stellen. Damit ein Roman funktioniert, ist es nach wie vor unerlässlich, dass sein Autor das Ereignisgerüst verschleiert. Erst dadurch wird eine Erzählform als moderner Roman kenntlich.
Es stellen sich den Schriftstellern und bildenden Künstlern heutzutage nicht nur Fragen, die die Kohlenstoffwirtschaftspolitik betreffen, sondern auch solche, die mit ihren eigenen Gepflogenheiten zu tun haben.
Damit sind wir bei der Ironie des „realistischen“ Romans angelangt: Der Gestus, mit dem er Realität hervorzaubert, dient in Wirklichkeit dem Verbergen des Realen. Und das heißt konkret: Das Kalkül, mit dem Wahrscheinlichkeit in die imaginäre Welt eines Romans eingebracht wird, ist nicht das Gleiche wie das Kalkül, dessen es außerhalb des Romans bedürfte. Ebendeshalb hört man häufig den Satz: „Wenn das in einem Roman stünde, würde es niemand glauben.“
Auf den Seiten eines Romans kann ein Ereignis, das im realen Leben eher unwahrscheinlich ist – beispielsweise die unerwartete Begegnung mit einem Spielkameraden aus der Kindheit, den man vor langer Zeit aus den Augen verloren hat –, ganz enorm unwahrscheinlich wirken. Es verlangt dem Autor eine Menge ab, es dennoch überzeugend darzustellen. Und wenn das schon auf einen kleinen glücklichen Zufall zutrifft, um wie vieles mehr muss ein Schriftsteller sich dann erst anstrengen, um eine Szene auszuarbeiten, die im realen Leben in höchsten Maßen unwahrscheinlich ist. Wie zum Beispiel eine Figur in genau dem Moment eine Straße entlanglaufen zu lassen, in dem sie von einem nie dagewesenen Wetterphänomen überfallen wird.
Der Supersturm Hurrikan Sandy, der 2012 New York traf, war ein solch höchst unwahrscheinliches Phänomen. Vermutlich wurde nie zuvor so häufig das Wort beispiellos zur Beschreibung eines Wetterereignisses verwendet. Der Physiker und Mathematiker Adam Sobel, dessen Schwerpunkt atmosphärische und klimatische Dynamiken sind, beschreibt in seiner vorzüglichen Studie über diesen Hurrikan, wie beispiellos dessen Bahn über der Ostküste der Vereinigten Staaten war.
Niemals zuvor hatte ein Hurrikan mitten über dem Atlantik so scharf nach Westen abgedreht. Nach diesem Richtungswechsel verschmolz er mit einem Wintersturm zu einem „Mammuthybriden“ von einem Ausmaß, das ebenso einmalig in den regionalen Wetteraufzeichnungen war wie die Sturmflut nie da gewesener Höhe, die dabei entfesselt wurde. Tatsächlich war Hurrikan Sandy ein so unwahrscheinliches Ereignis, dass er alle statistischen Wettervorhersagemodelle widerlegte.
Nur mit dynamischen, auf den Gesetzen der Physik beruhenden Modellen war man in der Lage gewesen, seine Bahn und seine Aufschläge exakt vorauszusagen.
Niemals zuvor hatte ein Hurrikan mitten über dem Atlantik so scharf nach Westen abgedreht. Nach diesem Richtungswechsel verschmolz er mit einem Wintersturm.
Doch die Risikoberechnungen, auf die Funktionäre ihre Notfallentscheidungen stützen, beruhen im Wesentlichen auf Wahrscheinlichkeitsmodellen. Und im Fall von Sandy war es, wie Sobel erläutert, ganz maßgeblich die Unwahrscheinlichkeit des Phänomens gewesen, die die Behörden dazu verleitet hatte, die Gefahr zu unterschätzen und ihre Notfallmaßnahmen viel zu spät einzuleiten. Wie schon viele andere Denker vor ihm ist auch Sobel überzeugt, der Mensch sei von seinem Wesen her unfähig, sich auf seltene Ereignisse vorzubereiten. Aber war das wirklich in der ganzen Menschheitsgeschichte der Fall? Ist es nicht eher eine Folge der unbewussten Denkmuster des „gesunden Menschenverstands“, die mit dem wachsenden Zutrauen in „die Gesetzmäßigkeit des bürgerlichen Lebens“ aufkeimten?
Ich vermute einmal, dass der Mensch im Grunde seines Herzens immer ein Katastrophist gewesen war, bis sein instinktives Wissen um die Unberechenbarkeit der Erde schließlich peu à peu durch einen uniformitaristischen Glauben ersetzt wurde – durch den Glauben an ein Ideensystem, das sich auf naturwissenschaftliche Theorien wie zum Beispiel die des britischen Geologen Charles Lyell stützte und durch eine Vielzahl staatlicher Maßnahmen auf der Basis von Statistiken und Wahrscheinlichkeitsrechnungen gefördert wurde.