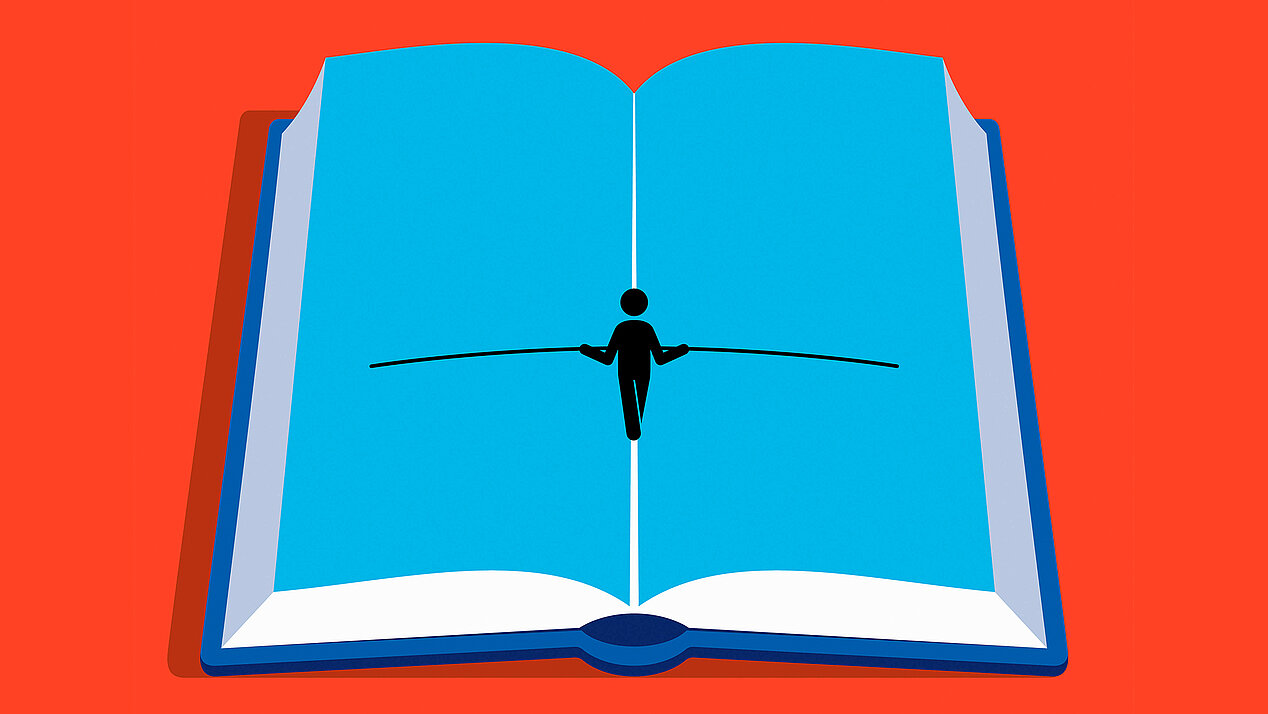Wenn man sich zum Thema Europa äußern soll, besteht eine der Hauptgefahren darin, in beruhigende und unstrittige Banalitäten abzugleiten. Über die wir uns dann alle, zumindest innerhalb des gesellschaftlichen Milieus, in dem diese Zeilen gelesen werden, unweigerlich einig sind: Ja, das Fremde ist es wert, entdeckt zu werden; ja, das Übersetzen ist eine gute Sache; ja, der Frieden zwischen den Völkern in unserer Weltgegend ist eine außerordentliche Errungenschaft und so weiter. Dennoch – hat man sich diese bedeutenden Leitsatze erst einmal an den Kopf geworfen, wird nichts dafür getan, sie konkret umzusetzen. Um nicht in die gleiche Falle zu tappen, möchte ich versuchen, einige anschauliche Begebenheiten aus meiner bruchstückhaften und anfechtbaren Erfahrung als Übersetzer (aus dem Deutschen) und als französischsprachiger Schriftsteller (der mehrere Bücher über deutsche Persönlichkeiten geschrieben hat) aufzugreifen.
Beginnen möchte ich mit einem Ereignis, das im Hinblick auf die Schwierigkeit, eine (konkrete) Praxis für und einen allgemeinen Diskurs über Europa zu formulieren, äußerst aufschlussreich und symptomatisch ist. Ich war eingeladen, im Maison de l‘Europe in Paris eine Gesprächsrunde mit dem bedeutenden österreichischen Schriftsteller Werner Kofler und seinem nicht weniger bedeutenden Übersetzer Bernard Banoun, dessen Arbeit in diesem Jahr mit dem Prix de Nerval ausgezeichnet wurde, zu leiten. Die Gesprächsrunde sollte sich des Themas Europa annehmen.
Da wir nichts Allgemeines über Europa zu sagen hatten oder uns dafür nicht zuständig fühlten, sprachen wir also zu dritt über die Besonderheiten der österreichischen Literatur, die Vorwürfe des Provinzialismus, denen sich auch Elfriede Jelinek ausgesetzt sah, sowie über den Einfluss von Thomas Bernhard und so weiter.
Wir unterhielten uns auf Deutsch, und ich übersetzte für das Publikum ins Französische. Unsere Ausführungen waren weder besonders akademisch noch schwer verständlich, vielmehr war es eine lebensnahe Erfahrung sprachlichen Miteinanders und europäischer Themen.
Der Leiter des ehrwürdigen Hauses aber versuchte uns zu unterbrechen, stieg auf das Podium und insistierte auf dem angekündigten Thema: Europa! In seinen Augen waren Bernhard, Jelinek und Kofler nicht „europäisch“ genug. Dann wiederholte er mit Nachdruck einen berühmten Ausspruch Umberto Ecos: „Die Übersetzung ist die Sprache Europas.“ Ohne jeden Willen zur Polemik bin ich der Ansicht, dass wir es hier mit einem guten Beispiel für die Gefahren von Allgemeinplätzen zu tun haben, die die Debatte plagen. Die Herausforderungen, mit denen Europa nämlich allzu oft zu tun hat, sind mitunter technischer und sogar ziemlich nüchterner Natur und betreffen die Übersetzung, das Dolmetschen sowie die Übersetzer- und Dolmetschervergütung.